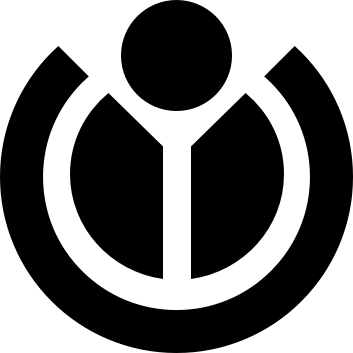In Ewigkeit online: Wie hat das Netz Mechanismen des Erinnerns verändert?
Welchen Einfluss hat das Internet auf unsere Erinnerungskultur?
PAUL KLIMPEL: Der wichtigste Punkt ist, dass sich im Digitalen die Grundlage dessen umkehrt, was erhalten und was zerstört wird. Nehmen wir das Beispiel eines Soldaten, der im Ersten Weltkrieg einen Feldpostbrief an seine Mutter daheim richtet. Dieser Brief, ein Stück Papier, bleibt erhalten. Er müsste aktiv vernichtet werden, verbrannt, geschreddert, um nicht bewahrt zu bleiben. Im Analogen existieren also neben den offiziellen Archivierungen, etwa in Form von Akten, ungezählte private Erinnerungsstränge. Deswegen machen wir noch heute interessante Zufallsfunde auf Dachböden.
Und im Digitalen?
Der Bundeswehrsoldat in Afghanistan, der eine E-Mail nach Hause schreibt, ist ein ganz anderer Fall. Denn diese E-Mail wird es in fünf oder zehn Jahren nicht mehr geben. Es sei denn, jemand unternähme aktiv etwas, um sie zu erhalten. Das ist ein entscheidender Unterschied. Einer, der sich darauf auswirkt, welche Rolle Archive spielen. Denn wenn man im Digitalen aktiv etwas tun muss, um Erinnerungsstücke zu erhalten, wird das vor allem dort passieren, wo Archive mit der entsprechenden Ausstattung diese Aufgabe erledigen. Das bedeutet, dass viele der zufälligen Erinnerungsstränge verloren gehen.
Erleben wir damit auch eine Umwertung unseres Begriffs, was Kulturgut und damit erhaltenswert ist?
Was die Vergangenheit angeht, so bewirkt die Digitalisierung eine leichtere Zugänglichkeit von Archivgut und damit einhergehend einen Verlust von Deutungshoheit der Kulturerbe-Einrichtung und eine Demokratisierung der Erinnerung.
Was heutige, digitale Zeugnisse angeht, so ist aus archivarischer Sicht das Digitale etwas extrem Flüchtiges. Archive wollen dagegen für die Ewigkeit bewahren. Es heißt ja immer: Das Netz vergisst nicht. Doch das stimmt so nicht. Versuchen Sie mal, eine zehn Jahre alte Website zu finden. Die ist weg. Vielleicht lässt sie sich noch mittels Wayback-Maschine aufspüren, aber sicher ist das nicht. Wenn vom Netz, das nicht vergisst, gesprochen wird, bezieht sich das auf seltene Fälle privater Fehltritte, die auch Jahre später noch zu googeln sind. Aber das würde man ja kaum als generationenübergreifende Erinnerung bezeichnen.

Wie verändern sich die Auswahlprozesse, die beeinflussen, was in ein Archiv gehört? Das Gros der E-Mails zum Beispiel dürfte für die Nachwelt kaum von Interesse sein.
Aber das ist seit eh und je die Krux von Archiven: zu entscheiden, was bewahrenswert ist. Diese Auswahlfrage wird immer kontrovers bleiben. Auch die digitale Speicherung ist zudem eine Frage von Ressourcen, genau wie im Analogen. Es genügt ja nicht, eine Terabyte-Festplatte zu kaufen. Langzeit-Archivierung im Digitalen ist eine sehr komplexe und teure Angelegenheit. Entsprechend wird es auch Diskussionen um den Auswahlprozess geben.
Wie lässt sich der Flüchtigkeit des Digitalen entgegenwirken?
Im Moment nur institutionell. Dafür müssen Strukturen und Institutionen geschaffen werden. Wenn niemand Twitter archiviert, zumindest ausschnittweise, wird man in 20 Jahren so etwas wie die #MeToo-Debatte nicht mehr nachvollziehen können. Vielleicht noch anhand von Sekundärquellen, weil es natürlich Zeitungsberichte darüber gibt. Aber nicht mehr aufgrund der Primärquellen.
An welche Art Institution denken Sie? Es gibt ja zum Beispiel das Internet Archive.
Das Internet Archive erledigt schon eine Menge, aber wichtig wäre es, die bestehenden Institutionen für die digitale Archivierung auszurüsten. Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) ist dafür prädestiniert, sie hat auch ein entsprechendes Mandat und es gibt auch Anstrengungen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Ein sinnvoller Ansatz wäre, dass man bei jedem Zitat einer Website einen Button „Archivierung“ anklicken könnte. Die DNB würde einen Permanent-Link erstellen. Wenn ich also in zwanzig Jahren auf dieses Zitat in einem wissenschaftlichen Artikel stoße und den Link anklicke, erscheint nicht „Page not found“. Sondern die entsprechende bei der DNB archivierte Seite.
Was die Auswahlfrage gleich mit klärt.
Und, wichtiger noch: Es ist nicht mehr eine Institution, die im Zweifel sogar politisch motiviert entscheidet, was bewahrt wird. Sondern es sind diejenigen, die etwas zitieren. Das ist mit vielen Problemen rechtlicher Art verbunden. Was, wenn eine Seite zitiert wird, die illegal ist und später verboten wird? Dennoch wäre der vernünftigste Ansatz, dort zu archivieren, wo ein entsprechender Bedarf formuliert wird.
Und wenn dabei Persönlichkeitsrechte betroffen sind? Etwa bei der #MeToo-Debatte auf Twitter?
Twitter ist eine öffentliche Sphäre. Wer dort schreibt, weiß, dass es von jedem gesehen werden kann. Anders als manche Datenschutzextremisten bin ich nicht der Meinung, dass etwas, das öffentlich geäußert wurde, im Nachhinein unter persönlichkeitsrechtlichem Schutz geheim gehalten werden soll. Öffentlicher Diskurs muss als solcher erhalten bleiben.
Wo sehen Sie bei der digitalen Archivierung Herausforderungen durch das Urheberrecht?
Die Frage betrifft ja vor allem den Zugang zu Materialien des 20. Jahrhunderts. Das größte Problem sind in meinen Augen die Kulturzeugnisse, bei denen die Frage des urheberrechtlichen Schutzes völlig unklar und teils auch nicht zu klären ist. Solange es dafür keine Lösung gibt, wird eine erhebliche Selektion von Erinnerung stattfinden. Ein Beispiel sind die sozialen Bewegungen: die Frauenbewegung, die Schwulenbewegung, die Anti-Atomkraftbewegung. Die haben Flugblätter verfasst, Broschüren geschrieben. Aber zu einem nicht unerheblichen Teil als Kollektive. Wer die Urheberin oder der Urheber ist, lässt sich unmöglich feststellen.
Welche Konsequenzen hat das?
Die Folge ist, dass solche Artefakte zum jetzigen Zeitpunkt nicht digital verfügbar gemacht werden können. Was bedeutet, dass soziale Bewegungen im digitalen Erinnern nicht vorkommen. Das Urheberrecht übt also – wenn auch nicht beabsichtigt – eine Zensurwirkung aus. Wie in so vielen Fällen. Wenn Sie heute eine Ausstellung organisieren oder ein Buch veröffentlichen, lautet die Frage nicht: Welches Foto ist am besten geeignet, um meine Aussage zu stützen?, sondern: Für welches Foto bekomme ich die Rechte? Juristinnen und Juristen werden wichtiger als Kuratierende. Was ich als Jurist für eine Katastrophe halte.
Wie kann man dem entgegenwirken?
Bei der Urheberrechtsreform, die jetzt im Zuge der Urheberrechtsrichtlinie kommt, wird es eine Erlaubnis geben, vergriffene Werke digital verfügbar zu machen. Je nachdem, welche Mechanismen dafür gefunden werden, könnte sich die Situation zumindest ein wenig entspannen. Das ist zu hoffen.
Weitere Infos
- Konferenzreihe “Zugang getsalten. Mehr Verantwortung für das kulturelle Erbe”
- Wikimedia-Salon “E=Erinnerung. Zeit des Vergessenwerdens?” mit Markus Beckedahl, Peggy Mädler und Mathias Berek