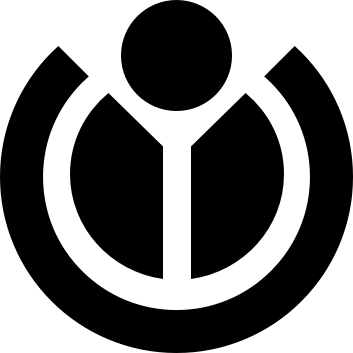S
Sprachgewalt
Eines der vier Grundprinzipien der Wikipedia ist der „Neutrale Standpunkt“. Aber was, wenn die Sprache selbst keinen neutralen Standpunkt bietet? Eines wird immer deutlicher: Digitale Architekturen haben einen großen Einfluss darauf, wie wir miteinander sprechen. Warum Gleichstellung geschlechtersensible Sprache braucht und wie gewaltvoller Sprache der Nährboden zugunsten einer konstruktiven Diskurskultur entzogen werden kann…
- Communitys
- Gemeinwohl
Ein Unterschied wie Tag und Nacht – Warum Gleichstellung geschlechtersensible Sprache braucht
Ein Essay.
Eines der vier Grundprinzipien der Wikipedia ist der „Neutrale Standpunkt“: Artikel sollen ihr Thema „weder mit abwertendem noch mit sympathisierendem Unterton“ aus einer „neutralen Sicht“ darstellen. Für eine Enzyklopädie ist das ein unverzichtbares Prinzip, auch wenn es in der Realität nur schwer umzusetzen ist – die seitenlangen hitzigen Diskussionen zu vielen Artikeln, die in traditionellen Redaktionen sicher ebenso geführt werden, zeigen das. Aber was, wenn die Sprache selbst keinen neutralen Standpunkt bietet?
“Die Sprachen, die wir heute sprechen, sind historisch gewachsen und die Standpunkte vergangener Gesellschaften sind tief in ihrem Wortschatz und ihrer Grammatik verankert.”
Anatol Stefanowitsch
Der traditionelle Sprachgebrauch – so selbstverständlich er uns durch die Macht der Gewohnheit sein mag – ist deshalb häufig nicht neutral, sondern vom abwertenden oder sympathisierenden Unterton dieser Gesellschaften geprägt. Nirgendwo wird das so deutlich wie beim Bezug auf Personen. Wie in vielen anderen Sprachen sind im Deutschen fast alle Personenbezeichnungen gegendert: Sie existieren in einer männlichen und in einer weiblichen Variante – geschlechtsneutrale Bezeichnungen gibt es im traditionellen Sprachgebrauch nur in Ausnahmefällen. Bezeichnungen, die Kategorien außerhalb des Männlichen und Weiblichen einschließen, gibt es gar nicht.
Das stellt uns zum einen vor Probleme, wenn es darum geht, geschlechtlich gemischte Gruppen oder abstrakte Kategorien von Personen zu bezeichnen. Zum anderen macht es den Bezug auf Menschen, die sich in den Kategorien „männlich“ und „weiblich“ nicht wiederfinden, fast unmöglich.

Lizenzhinweis

Gesellschaftliche Normalfälle und die goldene Regel
Für den Bezug auf geschlechtlich gemischte Gruppen oder abstrakte Kategorien von Personen bietet der traditionelle Sprachgebrauch eine einfache Lösung: Man verwende einfach männliche Formen und verlasse sich darauf, dass Frauen (und andere, dazu später mehr) sich schon irgendwie mitgemeint fühlen werden. In Texten – vor allem auch in enzyklopädischen – findet sich diese scheinbare Lösung immer noch mit großer Selbstverständlichkeit.
Es ist aber nur eine scheinbare Lösung, denn sie spiegelt eben einen Standpunkt wider, der alles andere als neutral ist: dass nämlich Männer der gesellschaftliche Normalfall und Frauen eine Art Nachgedanke sind. Das entspricht zwar sehr genau den Wertvorstellungen vergangener Gesellschaften, aber sicher nicht der unseren.
Wie wenig akzeptabel dieses Vorgehen ist, zeigt sich jedes Mal, wenn ein Text es umgekehrt versucht: Als die Universität Leipzig 2013 ihre Satzung überarbeitete und dabei alle (generisch intendierten) männlichen durch (generisch intendierte) weibliche Personenbezeichnungen ersetzte, gab es einen Sturm der Entrüstung in den klassischen ebenso wie in den sozialen Medien. Und als das Justizministerium 2020 in einem Gesetzesentwurf ebenso verfuhr, sah sich der Innenminister höchstpersönlich in der Pflicht, in das Verfahren einzugreifen und den männlichen Normalfall wiederherzustellen.
Wenn es nun aber für Männer nicht zumutbar ist, sich in der Satzung einer Universität, die die meisten von ihnen nie besucht haben, oder in einem Gesetzesentwurf, den die meisten von ihnen nie lesen werden, als Nachgedanke zu einem weiblichen Normalfall wiederzufinden, können sie es gemäß der goldenen Regel umgekehrt auch den Frauen nicht zumuten.
Paradoxe Oberbegriffe und Zusatzaufwand fürs Gehirn
Daran ändern auch die Versuche mancher sprachwissenschaftlicher Kolleginnen und Kollegen nichts, das Maskulinum zu einer „neutralen“ Form umzudefinieren. Das funktioniert schon auf der sprachsystemischen Ebene nicht. Begründet wird die vermeintliche Neutralität des Maskulinums häufig mit der sogenannten Markiertheitstheorie. Die Wörter _Tag_ und _Nacht_ sind hierfür ein gutes Beispiel: Das Wort _Tag_ kann, in einen Gegensatz zu _Nacht_ gestellt, den „Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang“ bezeichnen („Heute ist der kürzeste Tag des Jahres“), oder es kann sich auf eine „Zeitspanne von 24 Stunden“ beziehen (wenn ich sage: „Sie hat seit drei Tagen Fieber“ umfasst das auch die Nächte) und ist dann, paradoxerweise, Oberbegriff von _Tag_ und _Nacht_.
Genauso, argumentieren manche meiner Kollegen, sei es auch mit männlichen und weiblichen Personenbezeichnungen: ein Wort wie _Redakteur_ bezeichne entweder, im Gegensatz zur _Redakteurin_, einen Mann, der die entsprechende Tätigkeit ausübt, oder, als Oberbegriff von _Redakteur_ und _Redakteurin_, eine geschlechtlich nicht näher spezifizierte Person, die dies tut. Selbst, wenn diese Analyse stimmen sollte (und daran darf man zweifeln), ändert sie nichts am Kern des Problems. Der Grund, warum wir das Wort _Tag_ als Oberbegriff für _Tag und Nacht_ gewählt haben, und nicht das Wort _Nacht_, ist ja, dass der Tag für uns der Normalfall ist. Hier spielt sich der überwiegende Teil des gesellschaftlichen Lebens ab, während wir nachts doch meistens schlafen.
Es braucht aber gar keine sprachsystemischen Analysen, um zu realisieren, dass das generische Maskulinum nicht neutraler oder gerechter ist, als es ein generisches Femininum wäre: Psychologinnen und Psychologen untersuchen die Interpretation dieser Form seit zwanzig Jahren im Labor und haben wieder und wieder gezeigt, dass das Maskulinum, ganz egal, wie es im Einzelfall gemeint sein mag, von deutschsprachigen Menschen zunächst männlich interpretiert wird – und dass eine generische Interpretation einen Zusatzaufwand bedeutet, den unser Gehirn nicht immer auf sich nimmt.
Ein neutraler Sprachgebrauch erfordert also mindestens, den männlichen Personenbezeichnungen die weiblichen zur Seite zu stellen. Das mag einen Text etwas länger machen, aber für die größere sprachliche Präzision und die neutrale Darstellung der Welt können wir das wohl in Kauf nehmen.
Doppelform, Unterstrich, Gendersternchen
Damit ist aber noch nicht berücksichtigt, dass es Personen gibt, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht in den Kategorien „Mann“ und „Frau“ wiederfinden. Ich schreibe hier bewusst „aus welchen Gründen auch immer“, weil die Diskussion um sprachliche Neutralität an dieser Stelle häufig in eine Diskussion darüber umschlägt, ob es neben dem (oder außerhalb des) Männlichen und Weiblichen überhaupt geschlechtsrelevante Kategorien geben kann.
Wenn wir sie mit „Nein“ beantworten, könnten wir bei Doppelformen wie _Redakteur und Redakteurin_ bleiben. Wenn wir sie mit „Ja“ beantworten, müssen wir zu neuen Formen wie dem Gendersternchen oder dem Unterstrich greifen. In beiden Fällen beziehen wir eine Position, die uns selbstverständlich zusteht, für deren Konsequenzen wir dann aber auch die Verantwortung übernehmen müssen.
Neutral ist keine dieser Positionen, wobei das Bestehen auf einer Zweigeschlechtlichkeit zumindest durch die wissenschaftlich unstrittige Existenz von intersexuellen Personen sicher die weniger gut begründbare ist. Wer um Neutralität bemüht ist, muss auf die wenigen Möglichkeiten geschlechtsneutraler Personenbezeichnungen ausweichen, die das Deutsche uns bietet. Das sind vor allem Partizipien im Plural, mit denen wir durchaus kreativer umgehen können als der traditionelle Sprachgebrauch uns Glauben macht – statt _Redakteure und Redakteur*innen_ oder _Redakteur*innen_ können wir etwa _in der Redaktion Tätige_ sagen.
Länger als _Redakteur und Redakteurin_ ist das auch nicht. Aber neutraler ist es auf jeden Fall.
Weitere Infos
Die Architektur der Gewalt.
Ein Gespräch.
Gegenderte Sprache hat sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens durchgesetzt. Auf der anderen Seite scheint im Netz, gerade angesichts einer gärenden Krisenstimmung, die Sprachverrohung noch zuzunehmen. Driften die Sphären immer weiter auseinander?
KÜBRA GÜMÜȘAY: Gesellschaft funktioniert in Gleichzeitigkeiten, es gibt weder nur Fortschritte noch ausschließlich Rückschritte. Wir haben heute ein ausgeprägteres Bewusstsein dafür, dass unsere Gesellschaft, so wie sie ist, nicht fertig sein muss. Sondern dass wir Menschen eigentlich die Werkzeuge in der Hand hätten, um ein gerechteres Miteinander zu ermöglichen. Das hat zum Teil mit dem Internet zu tun, das andere Lebensrealitäten sichtbarer macht, uns aber auch vor Augen führt, dass es sich bei manchen Werten, die wir als Grundrechte formuliert haben, um Utopien handelt, nicht um Tatsachenbeschreibungen. Die Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit werden sichtbarer, und das erzeugt Reibung. Die braucht eine Gesellschaft im Wandel aber auch.
„Ja, die Mehrheit ist laut. Aber das Problem sind die stillen Mitlesenden. Die 80 Prozent der Menschen, die Hassrede passieren lassen, statt ein Gespräch anzubieten, eine Haltung erkennen zu lassen, eine Gegenposition einzunehmen.“
Christina Dinar
CHRISTINA DINAR: Was mich beschäftigt, ist die Frage, inwiefern wir uns auch im Netz überhaupt noch begegnen und aufeinander einlassen. Wir müssen keine gemeinsame Sprache sprechen, wir müssen auch nicht alle gendern. Aber wir sollten Begegnungen zulassen, selbst wenn sie manchmal schmerzhaft sind. Von den wachsenden Polarisierungen profitieren vor allem Rechtsextreme und Populisten. Das sieht man aktuell bei den Menschen, die sich von der Querdenkerbewegung oder Corona-Leugnenden mobilisieren lassen, schlicht aufgrund ihrer großen Verunsicherung.
GÜMÜȘAY: Was wir brauchen, ist eine suchende Sprache. Es existiert ja kein Parallel-Duden, in dem die Wörter verzeichnet sind, die man benutzen darf oder nicht. Das Gendersternchen ist auch für mich nicht die perfekte Lösung – aber unter den aktuell zur Auswahl stehenden eine praktikable. Natürlich stellt sich viel grundsätzlicher die Frage, weshalb man überhaupt spezifizieren muss, welches Geschlecht eine Person hat, was doch häufig komplett irrelevant für den Kontext ist. Aber tatsächlich ist das Suchende, das Bewusstsein um die eigene Begrenztheit, notwendig, um in einen Dialog treten zu können. Stattdessen erleben wir ein Aufeinanderprallen von Absolutheitsansprüchen.

Erscheint das Problem der Hassrede im Netz auch deshalb so groß, weil eine aggressive Minderheit allein durch Lautstärke den Eindruck erweckt, die Mehrheit zu sein?
DINAR: Ja, die Mehrheit ist laut. Aber das Problem sind die stillen Mitlesenden. Die 80 Prozent der Menschen, die Hassrede passieren lassen, statt ein Gespräch anzubieten, eine Haltung erkennen zu lassen, eine Gegenposition einzunehmen – um den Austausch voranzubringen. Eigentlich sollte das Internet genau das ermöglichen, tatsächlich begünstigt es scheinbar den Rückzug. Das passive Konsumieren schafft den Boden für die Extreme, statt Empathie beobachten wir Schaukämpfe um Deutungshoheit.
GÜMÜȘAY: Rücksichtnehmen, Raum für Zweifel lassen – das sind Ressourcen, die aufgebraucht werden können. Was wir in der Pandemie erleben, fühlt sich an wie ein Stau in Istanbul, New York oder Kairo, wo alle nach anderthalb Stunden so gereizt sind, dass sie nur darauf warten, provoziert zu werden, um endlich ihre Wut entladen zu können. Ich finde allerdings die ständigen Appelle an Menschen problematisch, sich doch bitte anders zu verhalten. Stattdessen sollten wir auf die Architektur der Plattformen schauen, wo diese Sprachgewalt sich ereignet. Architektur hat Einfluss darauf, wie wir uns in dem jeweiligen Raum bewegen, sie erzieht uns zu einem bestimmten Verhalten. Das heißt, jedes Mal, wenn gewaltvolle Worte und Narrative unwidersprochen bleiben, wird ein Exempel dafür statuiert, was vermeintlich sagbar ist.
„Gegenrede fühlt sich für mich an, als würde man eine Tür unter hohem Druck zuhalten – um zu verhindern, dass eine gewaltvolle Ideologie mehr Macht und Raum gewinnt. Aber das bedeutet auch Stillstand.“
Kübra Gümüșay
Reichen die bestehenden Gesetze gegen Hassrede aus?
DINAR: In Deutschland haben wir ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, auf europäischer Ebene wird es bald den Digital Services Act geben. Das NetzDG soll den Userinnen und Usern die Möglichkeit geben, Inhalte zu melden, die strafrechtlich relevant sind, Beleidigungen und anderes. Erst kürzlich ist eine Erhebung dazu erschienen. Die Bewertung ist schwierig, weil die Plattformen, die unter dieses Gesetz fallen – das sind alle, die in Deutschland über zwei Millionen Userinnen und User haben – ihre Transparenzberichte nach eigenen Kriterien und nicht einheitlich gestalten. Auf Twitter wurden im zweiten Halbjahr 2020 nach diesem Verfahren 800.000 Posts gemeldet, bei Youtube 300.000, auf Tiktok 250.000 – und bei Facebook? 5.000 Posts. Daran sieht man schon, wie Plattformen ihre Macht nutzen, um Beschwerden zu umgehen. Bei Facebook ist das Meldeverfahren so komplex gestaltet, dass es kaum genutzt wird.
Welche Strategien bewähren sich nach Ihrer eigenen Erfahrung gegen Hassrede?
GÜMÜȘAY: Eine wirksame Strategie, die aber kaum diskutiert wird: Wir suchen uns aus, mit wem wir sprechen. Wenn wir als Referenz immer wieder diejenigen Menschen zulassen, die am gewaltvollsten agieren, am aggressivsten, dann infantilisieren wir jegliche Form von Diskurs. Teilweise auch, weil es uns dann leichter fällt, uns über diese Menschen zu erheben und eine Position komplett zu delegitimieren. Die wirksamste Strategie ist, gewaltvolle Sprache nicht mit Aufmerksamkeit zu nähren.
DINAR: Interessant! Das war ja lange der Netiquette-Tipp für den Umgang mit unangebrachter Rede im Internet: Don’t feed the troll. In den vergangenen Jahren ist dieser Imperativ aber zurückgetreten hinter die Forderung nach aktiver Gegenrede…
GÜMÜȘAY: Gegenrede fühlt sich für mich an, als würde man eine Tür unter hohem Druck zuhalten – um zu verhindern, dass eine gewaltvolle Ideologie mehr Macht und Raum gewinnt. Aber das bedeutet auch Stillstand. Wenn ein Großteil unserer Ressourcen in Widerstand fließt und nur wenig in den Aufbau der Diskurskultur, die wir uns wünschen, dann stagnieren wir als Gesellschaft. Das lässt sich auf alle möglichen sozialen Bewegungen übertragen. Wenn antirassistische Arbeit primär bedeutet, Widerstand gegenüber rassistischer Sprache und Gewalt zu leisten, aber keine Räume entstehen, wo man sich darin übt, rassismuskritischer miteinander umzugehen, dann stagniert eine Bewegung.
DINAR: Meine Erfahrung aus dem Digital Streetwork ist, dass Kommunikation immer auch einen Lernprozess bedeutet. Und jeder Inhalt, den eine Community ächtet, wo sie eine klare Grenze zieht – etwa: Diese Haltung passt nicht zu unserem Konzept von Gleichheit – kann dieses Lernen bestärken und Impulse geben.
Weitere Infos: