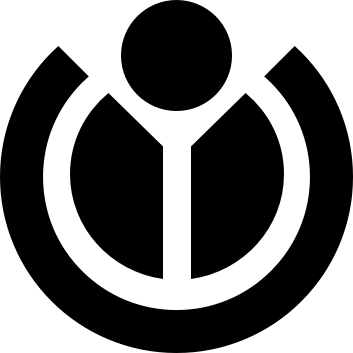Die Architektur der Gewalt.
Ein Gespräch.
Gegenderte Sprache hat sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens durchgesetzt. Auf der anderen Seite scheint im Netz, gerade angesichts einer gärenden Krisenstimmung, die Sprachverrohung noch zuzunehmen. Driften die Sphären immer weiter auseinander?
KÜBRA GÜMÜȘAY: Gesellschaft funktioniert in Gleichzeitigkeiten, es gibt weder nur Fortschritte noch ausschließlich Rückschritte. Wir haben heute ein ausgeprägteres Bewusstsein dafür, dass unsere Gesellschaft, so wie sie ist, nicht fertig sein muss. Sondern dass wir Menschen eigentlich die Werkzeuge in der Hand hätten, um ein gerechteres Miteinander zu ermöglichen. Das hat zum Teil mit dem Internet zu tun, das andere Lebensrealitäten sichtbarer macht, uns aber auch vor Augen führt, dass es sich bei manchen Werten, die wir als Grundrechte formuliert haben, um Utopien handelt, nicht um Tatsachenbeschreibungen. Die Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit werden sichtbarer, und das erzeugt Reibung. Die braucht eine Gesellschaft im Wandel aber auch.
„Ja, die Mehrheit ist laut. Aber das Problem sind die stillen Mitlesenden. Die 80 Prozent der Menschen, die Hassrede passieren lassen, statt ein Gespräch anzubieten, eine Haltung erkennen zu lassen, eine Gegenposition einzunehmen.“
Christina Dinar
CHRISTINA DINAR: Was mich beschäftigt, ist die Frage, inwiefern wir uns auch im Netz überhaupt noch begegnen und aufeinander einlassen. Wir müssen keine gemeinsame Sprache sprechen, wir müssen auch nicht alle gendern. Aber wir sollten Begegnungen zulassen, selbst wenn sie manchmal schmerzhaft sind. Von den wachsenden Polarisierungen profitieren vor allem Rechtsextreme und Populisten. Das sieht man aktuell bei den Menschen, die sich von der Querdenkerbewegung oder Corona-Leugnenden mobilisieren lassen, schlicht aufgrund ihrer großen Verunsicherung.
GÜMÜȘAY: Was wir brauchen, ist eine suchende Sprache. Es existiert ja kein Parallel-Duden, in dem die Wörter verzeichnet sind, die man benutzen darf oder nicht. Das Gendersternchen ist auch für mich nicht die perfekte Lösung – aber unter den aktuell zur Auswahl stehenden eine praktikable. Natürlich stellt sich viel grundsätzlicher die Frage, weshalb man überhaupt spezifizieren muss, welches Geschlecht eine Person hat, was doch häufig komplett irrelevant für den Kontext ist. Aber tatsächlich ist das Suchende, das Bewusstsein um die eigene Begrenztheit, notwendig, um in einen Dialog treten zu können. Stattdessen erleben wir ein Aufeinanderprallen von Absolutheitsansprüchen.

Erscheint das Problem der Hassrede im Netz auch deshalb so groß, weil eine aggressive Minderheit allein durch Lautstärke den Eindruck erweckt, die Mehrheit zu sein?
DINAR: Ja, die Mehrheit ist laut. Aber das Problem sind die stillen Mitlesenden. Die 80 Prozent der Menschen, die Hassrede passieren lassen, statt ein Gespräch anzubieten, eine Haltung erkennen zu lassen, eine Gegenposition einzunehmen – um den Austausch voranzubringen. Eigentlich sollte das Internet genau das ermöglichen, tatsächlich begünstigt es scheinbar den Rückzug. Das passive Konsumieren schafft den Boden für die Extreme, statt Empathie beobachten wir Schaukämpfe um Deutungshoheit.
GÜMÜȘAY: Rücksichtnehmen, Raum für Zweifel lassen – das sind Ressourcen, die aufgebraucht werden können. Was wir in der Pandemie erleben, fühlt sich an wie ein Stau in Istanbul, New York oder Kairo, wo alle nach anderthalb Stunden so gereizt sind, dass sie nur darauf warten, provoziert zu werden, um endlich ihre Wut entladen zu können. Ich finde allerdings die ständigen Appelle an Menschen problematisch, sich doch bitte anders zu verhalten. Stattdessen sollten wir auf die Architektur der Plattformen schauen, wo diese Sprachgewalt sich ereignet. Architektur hat Einfluss darauf, wie wir uns in dem jeweiligen Raum bewegen, sie erzieht uns zu einem bestimmten Verhalten. Das heißt, jedes Mal, wenn gewaltvolle Worte und Narrative unwidersprochen bleiben, wird ein Exempel dafür statuiert, was vermeintlich sagbar ist.
„Gegenrede fühlt sich für mich an, als würde man eine Tür unter hohem Druck zuhalten – um zu verhindern, dass eine gewaltvolle Ideologie mehr Macht und Raum gewinnt. Aber das bedeutet auch Stillstand.“
Kübra Gümüșay
Reichen die bestehenden Gesetze gegen Hassrede aus?
DINAR: In Deutschland haben wir ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, auf europäischer Ebene wird es bald den Digital Services Act geben. Das NetzDG soll den Userinnen und Usern die Möglichkeit geben, Inhalte zu melden, die strafrechtlich relevant sind, Beleidigungen und anderes. Erst kürzlich ist eine Erhebung dazu erschienen. Die Bewertung ist schwierig, weil die Plattformen, die unter dieses Gesetz fallen – das sind alle, die in Deutschland über zwei Millionen Userinnen und User haben – ihre Transparenzberichte nach eigenen Kriterien und nicht einheitlich gestalten. Auf Twitter wurden im zweiten Halbjahr 2020 nach diesem Verfahren 800.000 Posts gemeldet, bei Youtube 300.000, auf Tiktok 250.000 – und bei Facebook? 5.000 Posts. Daran sieht man schon, wie Plattformen ihre Macht nutzen, um Beschwerden zu umgehen. Bei Facebook ist das Meldeverfahren so komplex gestaltet, dass es kaum genutzt wird.
Welche Strategien bewähren sich nach Ihrer eigenen Erfahrung gegen Hassrede?
GÜMÜȘAY: Eine wirksame Strategie, die aber kaum diskutiert wird: Wir suchen uns aus, mit wem wir sprechen. Wenn wir als Referenz immer wieder diejenigen Menschen zulassen, die am gewaltvollsten agieren, am aggressivsten, dann infantilisieren wir jegliche Form von Diskurs. Teilweise auch, weil es uns dann leichter fällt, uns über diese Menschen zu erheben und eine Position komplett zu delegitimieren. Die wirksamste Strategie ist, gewaltvolle Sprache nicht mit Aufmerksamkeit zu nähren.
DINAR: Interessant! Das war ja lange der Netiquette-Tipp für den Umgang mit unangebrachter Rede im Internet: Don’t feed the troll. In den vergangenen Jahren ist dieser Imperativ aber zurückgetreten hinter die Forderung nach aktiver Gegenrede…
GÜMÜȘAY: Gegenrede fühlt sich für mich an, als würde man eine Tür unter hohem Druck zuhalten – um zu verhindern, dass eine gewaltvolle Ideologie mehr Macht und Raum gewinnt. Aber das bedeutet auch Stillstand. Wenn ein Großteil unserer Ressourcen in Widerstand fließt und nur wenig in den Aufbau der Diskurskultur, die wir uns wünschen, dann stagnieren wir als Gesellschaft. Das lässt sich auf alle möglichen sozialen Bewegungen übertragen. Wenn antirassistische Arbeit primär bedeutet, Widerstand gegenüber rassistischer Sprache und Gewalt zu leisten, aber keine Räume entstehen, wo man sich darin übt, rassismuskritischer miteinander umzugehen, dann stagniert eine Bewegung.
DINAR: Meine Erfahrung aus dem Digital Streetwork ist, dass Kommunikation immer auch einen Lernprozess bedeutet. Und jeder Inhalt, den eine Community ächtet, wo sie eine klare Grenze zieht – etwa: Diese Haltung passt nicht zu unserem Konzept von Gleichheit – kann dieses Lernen bestärken und Impulse geben.
Weitere Infos: