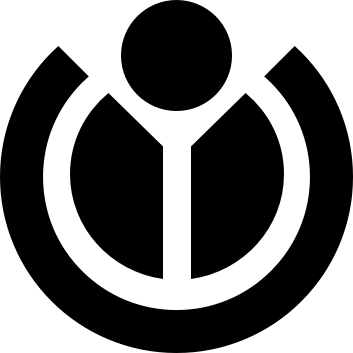Der Wert der Offenheit
Interview mit tante (aka Jürgen Geuter)
Das Paradigma der Offenheit hat viele Initiativen hervorgebracht, von Open-Source-Software über Open Data bis zu Open Science. Gefühlt hat die Aufbruchstimmung allerdings in den vergangenen zehn Jahren abgenommen. Was haben die Open-Bewegungen in Ihren Augen erreicht?
Auf einem bestimmten Level haben die Open-Bewegungen sehr viel erreicht. Weite Teile des Internets laufen auf Open-Source-Software, der Kern von Android ist Open Source. Open Data ist ein Schlagwort, an dem auch die Digitalministerin nicht mehr vorbeikommt. Die Begriffe – Open Source, Open Data, auch Open Science – hatten einen gewissen Impact. Aber das Versprechen und die Hoffnungen, die damit verbunden waren, haben sich bis heute nicht erfüllt.
Aus welchen Gründen?
Oft spielen die Motivationen der Akteurinnen und Akteure eine Rolle. Open-Source-Software zu monetarisieren, ist zum Beispiel extrem schwierig, was die Finanzierung solcher Projekte sehr herausfordernd gestaltet. Open Data ist zwar in aller Munde, aber diejenigen, die diese offenen Daten anbieten könnten, füllen den Begriff nicht affirmativ mit Leben. Das gilt auch für Open Science: Wenn junge Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler zum Beispiel einen Datensatz von Facebook zur Verfügung gestellt bekommen, können sie ihn entweder öffentlich machen. Oder sie forschen alleine daran und stricken exklusiv ein paar Paper und ihre Dissertation daraus.
Egoismus siegt über Openness?
Wir haben keine Kultur und auch keine ökonomische Struktur, die diese Open-Varianten grundsätzlich stützt. Open bedeutet immer: Ich gebe Kontrolle über Daten ab, ich gebe Exklusivität auf. Diese Exklusivität ist aber häufig genau das, was man monetarisieren kann. Damit lässt sich Einkommen sichern, Karriere, Reputation. Als die Open-Bewegung so stark startete, standen dahinter Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter. Zum Beispiel die Menschen, die in der Wikipedia schreiben, aus der Überzeugung, dass von Freiem Wissen alle Menschen profitieren sollten. Jetzt aber schlagen diese Open-Begriffe in der allgemeinen Gesellschaft auf – und dort, so bitter es ist, wird dieser sehr abstrakte Wert von Openness wenig wertgeschätzt. Weil er praktisch nichts bedeutet. Dass irgendwo tolle Daten liegen, hilft erst mal nur denen, die programmieren können. Open Science – das klingt schön und gut. Aber wer liest am Ende diese Paper? Wer kann das überhaupt?

Die Angebote bleiben jeweils in der eigenen Nische verhaftet?
Ja, und das ist die Schwierigkeit, die das Paradigma der Offenheit hat. Es bietet theoretisch extrem viel an – Freiheit, die Möglichkeit, Dinge auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden, Transparenz – aber ich muss extrem viel investieren, damit sich das auch einlöst. Deswegen haben diese Bewegungen nicht so viel erreicht, wie sie wollten. Als das Konzept Open die Blase der Enthusiastinnen und Enthusiasten, die Blase der Expertinnen und Experten verlassen hat, fiel auf: Ach so, nicht jeder kann programmieren. Ach so, nicht jeder hat Lust, täglich in der Wikipedia Artikel zu formatieren. Alle finden die Wikipedia toll. Plötzlich gibt es ein freies Nachschlagewerk von ziemlich hoher Qualität. Aber was für die meisten relevant ist: dass sie nichts dafür zahlen müssen und dass es halbwegs vertrauenswürdig ist. Die Leute wollen vor allem den Zugang.
Könnte die Politik Impulse der Open-Bewegungen aufnehmen – auch im Sinne einer gemeinwohlorientierten Netzpolitik?
Auf jeden Fall. Für die Politik wäre Openness ein extrem guter Weg, Vertrauen zu gewinnen und Technikkompetenz auszustrahlen. Wenn der Staat Daten sammelt – außer es sind durch Datenschutz abgedeckte Informationen – dann sollten sie per Definition offen sein. Der Staat müsste im Einzelfall argumentieren, vor welcher Instanz auch immer, weshalb sie nicht offen sein sollten. Das wäre ein Paradigma, das sich der Staat locker verordnen könnte. Tatsächlich verfügt er über extrem viele wertvolle Informationen: seien es Karten-Daten, Daten über den ÖPNV, Stromverbrauch, Bevölkerungsentwicklung – Daten, mit denen sich wirklich etwas anfangen ließe, gerade im Hinblick auf z. B. neue Mobilitätsherausforderungen. Hier bleibt der Staat aber in puncto Offenheit weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Man kann zwar Daten anfordern – bekommt aber im Zweifelsfall PDFs, die Scans von Ausdrucken sind. Definitiv keine Daten, die man benutzen könnte.
Was könnte mehr Offenheit vonseiten des Staates bewirken?
Wir erleben momentan eine Krise des Vertrauens in Institutionen. Und die hat auch mit fehlender Transparenz zu tun. Beispiel Netzpolitik: Es wird hinter verschlossenen Türen mit Netzbetreibern verhandelt, und am Ende lautet das Ergebnis, man könne ihnen nicht zumuten oder sie nicht dazu zwingen, allen einen tauglichen Internetanschluss nach Hause zu legen. Wenn der Staat die Zahlen auf den Tisch legen würde, auf deren Basis argumentiert wird, könnte man sicher sein, dass sich genügend Menschen finden, die Modelle bauen, um das gegenzurechnen. Okay, was kostet es denn, Glasfaserkabel für alle zu verlegen? Fünf Milliarden? Gut, dann kaufen wir drei Panzer weniger. Erledigt. Das wäre eine Möglichkeit, die politische Diskussion extrem zu verändern und denjenigen Menschen Argumente an die Hand zu geben, die für ein Gemeinwohl streiten.
Gemeinwohl ist ja ebenfalls ein Wert, der schwer zu qualifizieren ist.
Um wirklich ein Gemeinwohl aus den Open-Bewegungen erwachsen zu lassen, muss man auch ihre Probleme adressieren. Es genügt eben nicht, irgendwelche Daten irgendwo hinzulegen. Da wird man immer wieder an den Punkt gelangen, dass viel Geld rausgeworfen wurde, aber niemand sie sich heruntergeladen, geschweige denn sinnvoll genutzt hat. Man muss erst krabbeln lernen, bevor man zu laufen anfängt. Die Impulse der Open-Bewegung aufzunehmen, heißt: Daten liegen offen. Aber sie besser aufzunehmen, das bedeutet: Man gibt den Nukleus einer Benutzbarkeit dazu, man baut zum Beispiel eine rudimentäre Web-Anwendung dazu, mit der die Daten ein wenig exploriert werden können, z. B. indem man einfache Diagramme erzeugen kann. Dann wird sich sehr schnell zeigen, was die Leute für geiles Zeug damit anfangen. Wir müssen erreichen, dass der Wert von Open passiv spürbar und aktiv umsetzbar wird.