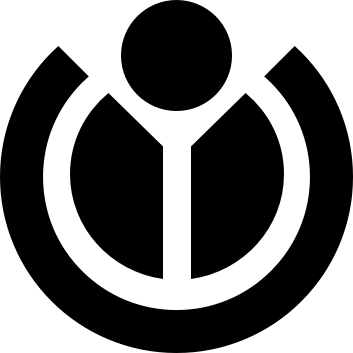Atem für die Langstrecke. Ein Interview.
Wie hat die Digitalisierung beziehungsweise die Vernetzung der Gesellschaft Interessenvertretung und Lobbying verändert?
Auch im Bereich Lobbying hat die Digitalisierung – oder besser: die digitale Transformation – dazu geführt, dass die Rolle von Gatekeepern dramatisch an Bedeutung verloren hat. Wikipedia ist ein gutes Beispiel dafür. Früher gab es die traditionellen Gatekeeper in Verlagen und Redaktionen, die Enzyklopädien geschrieben haben. Deren Macht aber ist durch die Wissens-Communitys im Netz infrage gestellt – und solche Entwicklungen lassen sich in vielen Bereichen beobachten. Die Folge für das Lobbying ist, dass zumindest in der Theorie mehr Menschen Einfluss auf politische Entscheidungswege nehmen können, die früher keine oder kaum Möglichkeiten dazu hatten. Das ist eine klare Veränderung durch die digitale Transformation.
An welche Entscheidungswege denken Sie zum Beispiel?
An eine ganze Reihe von Online-Petitionen oder Volksbegehren, die früher so nicht funktioniert hätten. Nicht, weil die Themen damals keine Relevanz besessen hätten. Aber Beispiele wie die Volksbegehren „Deutsche Wohnen enteignen“, oder die Initiative gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes in Berlin zeigen, dass es heute rein technisch einfacher ist, größere Massen an Menschen im Netz zu mobilisieren – auch dank der dramatisch gesunkenen Gemeinkosten, die damit verbunden sind. Man muss keine Flyer mehr drucken, keine Kampagnenstände aufbauen. Stattdessen ist es möglich, in größeren Netzwerken zu kommunizieren und damit schnell und effektiv Unterstützung zu generieren. Masse – selbst simulierte Masse – ist eine wirksame Möglichkeit, Einfluss auszuüben. Das wissen wir aus dem klassischen Lobbying.
Handelt es sich dabei um flüchtigere oder fluidere Crowds im Vergleich zu analogen Zeiten, als Unterstützende mit mehr Aufwand mobilisiert werden mussten?
Ein faszinierendes, wenn auch nicht eins zu eins auf Deutschland übertragbares Phänomen sehen wir in den USA: Dort kann man mit allen Anliegen die eigene Kongressabgeordnete oder den eigenen Kongressabgeordneten anrufen. Da bietet sich eine interessante Kombination aus analogem und liquidem Lobbying an – Liquid Lobbying verstanden als dezentrales Netzwerk von ehrenamtlich Lobbyierenden. Nach allem, was man weiß, werden E-Mails von den Büros der Abgeordneten weitestgehend ignoriert. Telefonanrufe hingegen werden registriert und spielen eine wichtige Rolle bei der Erfassung der Meinung der eigenen Basis. Genau das lässt sich organisieren. Smartes Liquid Lobbying in den USA mobilisiert also analoge Telefonanrufe – mit den Mitteln der Crowd und des Netzwerkes.
Sie waren von 2009 bis 2014 Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland. Welche Herausforderungen lagen und liegen darin, eine Interessenvertretung für die Wikipedia-Communitys aufzubauen?
Lobbying – ob analog oder liquid spielt dabei keine Rolle – ist immer Langstrecke. Es ist komplexes Beziehungsmanagement, Beziehungsaufbau, immer wieder Nachhaken und Nachfassen, permanent im Gespräch bleiben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man eine gut geölte Organisation ist. Mir ist in den fünf Jahren als Geschäftsführer immer wieder positiv aufgefallen, wie leicht es für Wikimedia ist, ins Gespräch mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu kommen. Das hat viel mit der Arbeit der Ehrenamtlichen zu tun und dem guten Ruf, den die Wikipedia genießt. Vielen ist der Unterschied zwischen Wikimedia als Organisation und Wikipedia als Projekt kaum bewusst – aber das spielt keine Rolle, das Entscheidende ist das soziale Kapital, das durch die Wikipedia entstanden ist.
Welche Ressourcen verlangt Lobbying als Langstrecke?
Man muss dabei zwei Schritte unterscheiden. Der erste ist, initiale Aufmerksamkeit zu erreichen. Dafür gibt es im Netz Möglichkeiten, etwa, sich kurzfristig mit einer Hashtag-Kampagne ins Gespräch zu bringen. Allein die Tatsache, dass ein Thema im Netz Wellen schlägt, ist ja für analoge Medien – aber auch für politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger – relevant. #MeToo ist ein gutes Beispiel. Von den Missständen, die öffentlich gemacht wurden, konnte niemand ernsthaft überrascht sein. Aber durch die Kraft, die Direktheit, mit der die Betroffenen kommuniziert haben, ist eine Wirkung weit über das Netz hinaus erzielt worden. Bloß beginnt nach dem Aufmerksamkeits-Boom eben die Langstrecke, und die ist mühsam. Was es dafür braucht, das ist eine smarte Bündelung ehrenamtlicher Kräfte, die sich über den ersten Impuls hinaus organisieren und an Bord bleiben.
Was ja für viele schon am Zeitaufwand scheitert …
Deswegen kann es gerade den Ehrenamtlichen helfen, auch den Schulterschluss mit hauptamtlichen Strukturen zu suchen, seien es Stiftungen, seien es Vereine. Gerade bei Leuten, die sich engagieren wollen, wird oft unterschätzt, dass Lobbying mehr ist, als für eine gute Sache Gutes zu tun. Es braucht Techniken, Erfahrungen, auch die Kenntnis und Akzeptanz von Spielregeln, die nun mal herrschen. Das gilt auch für eine soziale Bewegung wie Fridays for Future, der es hervorragend gelungen ist, initiale Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber um wirklich Veränderungen zu erreichen, müssen sich die Beteiligten eben langfristig an Lobbystrukturen beteiligen. Für die hauptamtlichen Strukturen wiederum ist es essenziell, die besondere Motivation, die Bedürfnislagen und die Anforderungen von ehrenamtlichen Strukturen nicht nur zu kennen, sondern zu respektieren und die eigene Arbeit entsprechend anzupassen.
Hat die Idee des Liquid Lobbying, wie es die Free Knowledge Advocay Group EU erprobt, auch in anderen Bereichen eine Zukunft?
Absolut. Wikipedia ist auch hier das beste Beispiel dafür, dass wir eine Aufgabe vollständig selbstorganisiert angehen können. Ohne Hierarchien, ohne Vorgaben, und in Verbindung mit hauptamtlichen Strukturen. Das macht Wikipedia einzigartig – aber auch zum Ansporn für Menschen, die sich anderen Aufgaben stellen wollen. Auch beim Klimawandel, bei der Pandemiebekämpfung, bei der Bekämpfung sozialer Ungleichheit und des globalen Hungers können und müssen wir nicht darauf warten, dass es die Politik für uns regelt, oder dass die Lobbyisten für uns streiten. Das gibt mir Hoffnung für die großen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.
Weitere Infos: