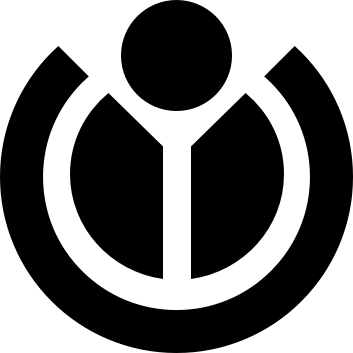Offener Zugang – Theorie und Praxis
Ein Interview mit Ellen Euler
Wo fehlt es gegenwärtig noch an digitalen Zugängen zu den Kulturerbe-Institutionen?
Zugang allein ist nicht alles. Zugang ist nicht der Kern von Open Access und Open Data. Selbst wenn man sich beispielsweise digitalisierte Gemälde ansehen kann wie im Museum, bleibt man Zuschauerin oder Zuschauer. Es geht doch aber darum, aus Zuschauenden Prosumerinnen und Prosumer* zu machen – zu ermöglichen, dass es Fortschreibungen des Kulturerbes gibt, einen Austausch zwischen den Generationen, dass Adaption, Wiederbelebung und Brauchbarmachung in der Gegenwart passieren können. Das ist im Digitalen insbesondere dann möglich, wenn man offene Schnittstellen, standardisierte Formate und freie Lizenzen hat, die ein Experimentieren zulassen, ein Arbeiten mit den Digitalisaten – und nicht nur die reine Reproduktion des Analogen ins Digitale.
Müssen vor allem rechtliche Hürden abgebaut werden?
Es ist noch nichts damit gewonnen, wenn die EU-Gesetzgebenden die nationalen Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber dazu anhalten, sie mögen bitte dafür Sorge tragen, dass keine Rechte mehr am Digitalisat entstehen und mithin Gemeinfreies gemeinfrei bleibt. Wenn dann wiederum ein Museum an Fotografieverboten im Haus festhält, keine 3-D-Digitalisate über offene Schnittstellen bereitstellt und keine offenen Daten in guter Qualität über Plattformen anbietet – dann bleibt es bei der Theorie. Dann ist gemeinfreier Inhalt nicht frei nutzbar. Der Fehler beginnt dort, wo Kulturerbe-Institutionen mit Unternehmen gleichgesetzt werden, die einen Return on Invest realisieren sollen. Kulturerbe-Institutionen versuchen das mit der Lizenzierung von Bildmaterial zu erreichen, das für die Digitalwirtschaft interessant ist, wie z. B. historische Aufnahmen oder Gemäldereproduktionen.

Dabei wird häufig übersehen, dass hierfür ein immenser Aufwand betrieben werden muss, um diese Einnahmen zu generieren. Es bedarf eigenen Personals für die Vermarktung und auch geeignete digitale Infrastrukturen, die erst mal finanziert werden müssen, und auch die Rechteverfolgung bei Lizenzverstößen und sonstigen sogenannten Transaktionskosten sind zu berücksichtigen. Um das alles zu finanzieren, muss erst mal Geld in die Hand genommen werden – und unterm Strich rechnet sich dieses Lizenzgeschäft nicht.
Trotzdem wird es von der Politik befördert. Daran kann die Rechtesituation erst mal nichts ändern, denn auch Gemeinfreies lässt sich vermarkten. Es gibt Institutionen, die digitale Angebote machen und dafür Geld verlangen. Aber nicht für die Rechte, sondern für den Service. Das heißt: Ein Digitalisat, eine Reproduktion wird zur Verfügung gestellt – und dieser Service kostet. In den AGB steht dann, dass das Bild nicht weiter verwendet werden darf. Da kann es so gemeinfrei sein, wie es will. Wir müssen also nicht nur die rechtlichen Hürden abbauen, sondern vor allem die strukturellen. Wir brauchen die Bilder in den Wikimedia-Projekten. Wir brauchen sie in der Wikidata und in der Wikipedia. Sonst ist nichts gewonnen.
Wer sollte dafür Sorge tragen – die Politik?
Es braucht einen Bewusstseinswandel – eben nicht nur in den Institutionen, sondern auch in den Trägereinrichtungen, bei den Fördernden, in der Förderpolitik. Ich glaube, dass die Institutionen und die Mitarbeitenden grundsätzlich den Willen zum Wandel haben. Aber dafür braucht es auch Kapazitäten und Ressourcen. Wenn Institutionen die Ressourcen nicht haben oder diese unter dem Finanzierungsvorbehalt stehen, dass sie sich auch rechnen, können sie die digitalen Angebote nicht schaffen und auch nicht frei zur Verfügung stellen. Politik, Förderung und die Strategie der Einrichtungen müssen Hand in Hand gehen. Der Auftrag aus der Politik an die Institutionen müsste lauten: mit der Zivilgesellschaft gemeinsam für die Allgemeinheit Angebote zu schaffen. Er müsste lauten: Wikification.
Alvin Toffler führte den Begriff 1980 in dem Buch Die dritte Welle (The Third Wave) für Personen ein, die zugleich Konsumenten als auch Produzenten des von ihnen verwendeten Produkts sind. Toffler sieht den Prosumenten als eine Person an, die ein Produkt oder eine Dienstleistung erzeugt und entwirft, um sie zu verbrauchen, also für den persönlichen Gebrauch.
[Quelle: Wikipedia]