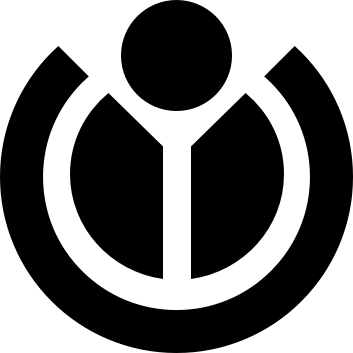Statement
Über Kollaboration
Kollaboration finde ich als Begriff zu unscharf. Commoning drückt viel mehr aus.
Kollaboration heißt im Grunde nichts anderes als Zusammenarbeiten. Das kann auf völlig verschiedenen Grundlagen passieren. Im Kapitalismus als Angestellte, durch die Marktwirtschaft verbunden auf derselben Baustelle als Handwerker*innen. Commoning dagegen ist durch andere Logiken geprägt. Zwei sind für mich entscheidend: zum einen Besitz statt Eigentum, zum anderen Beitragen statt Tauschen.
Besitz statt Eigentum gründet darauf, dass im deutschen Gesetzbuch eine Unterscheidung getroffen wird: Eigentum ist das, was einem rechtlich gehört. Besitz ist das, was man aktiv gebraucht. Wenn man das weiterdenkt, wären Besitzrechte in Ordnung, weil man etwas gebraucht. Aber etwas über die eigene Besitznahme hinaus in Eigentum zu verwandeln, bedeutet: Andere haben es nicht, brauchen es aber – und müssen einem deshalb Geld dafür geben. Das ist beim Commoning ausgeschlossen.
Beitragen statt Tauschen heißt: eine innere Motivation zu haben statt durch äußere Motivation getrieben zu sein. In den meisten Zusammenhängen besteht ja Zwang: Wir müssen unsere Miete bezahlen, also übernehmen wir im Zweifelsfall schlecht entlohnte Jobs. Das ist – um es mit dem alten Wort zu sagen – der Entfremdungseffekt. Oder auch: der Gummibärchen-Effekt. Wenn Menschen für ihr Handeln eine Belohnung bekommen, hören sie auf, von sich aus hilfsbereit zu sein. Die äußere, extrinsische Belohnung macht die innere, die intrinsische Motivation kaputt.

Es geht darum, jenseits dieser Markt- und Tauschlogik selbst entscheiden zu können, was wir mit unserem Leben machen. Es geht um eine ganz andere Form des Zusammenwirkens. Der Schwerpunkt ist: Wir entscheiden für uns selbst, aber auch miteinander, was wirklich wichtig ist.
Auf dieser Basis existiert Commoning oder Peer Production.
Eines der Prinzipien, das uns hilft, aus den gegebenen Logiken auszubrechen, ist die Fülle. Im Kapitalismus wird uns unentwegt vermittelt, alles sei knapp. Das ist etwas, was auch linke Theoretiker*innen oft zu sehr verinnerlicht haben – nur auf die Probleme zu schauen, darauf, was angeblich alles gerade nicht möglich ist.
Als ich vor 15 Jahren ein Buch über das Handeln der Menschen während der Finanzkrise in Argentinien geschrieben habe, bekam ich zu hören, es sei ja logisch, dass in so einer Situation viel solidarisches Wirtschaften möglich werde. Aber das sei eben die Krise.
Wenn wir hierzulande unsere solidarischen Praktiken betreiben – in Umsonst-Läden, mit Foodsharing etc. – dann heißt es: Klar, dass man das machen kann. Solange es noch so viel Wohlstand gibt.
Es geht immer darum, das zu nutzen, was da ist.
Solange wir komfortable Möglichkeiten haben, außerhalb von Tausch- und Marktlogik zu leben und neue Räume aufzubauen, nutzen wir das eben. Als Motor für Transformation.
Bini Adamczak bringt es in ihrem Buch „Beziehungsweise Revolution“ auf den Punkt: Die Zäsur, egal ob als Finanzkrise, Pandemie oder Umsturz – ist nicht die Revolution. Sondern die Revolution ist das, was sich in den Beziehungsweisen zwischen Menschen vorher geändert hat. Und was sich hinterher weiter ändert.
In der Krise greifen zwar Wissen oder andere Denkweisen auf viel mehr Menschen aus als vorher. Aber die Erfahrung, z. B. in Argentinien, zeigt auch: Verbreiten kann sich nur das, was bereits in der Welt ist, was vorher schon gelebt wird: in Beziehungsweisen, die Räume anderer Selbstverständlichkeit oder auch Halbinseln gegen den Strom bilden.
Weitere Infos:
- Friederike Habermann bei Wikipedia
- Wikimedia-Salon „K=Kollaboation: Ohne Zusammenarbeit keine Commons?“ mit Friederike Habermann, Mark Terkessidis und Christoph Kappes