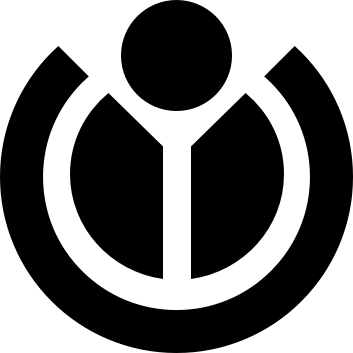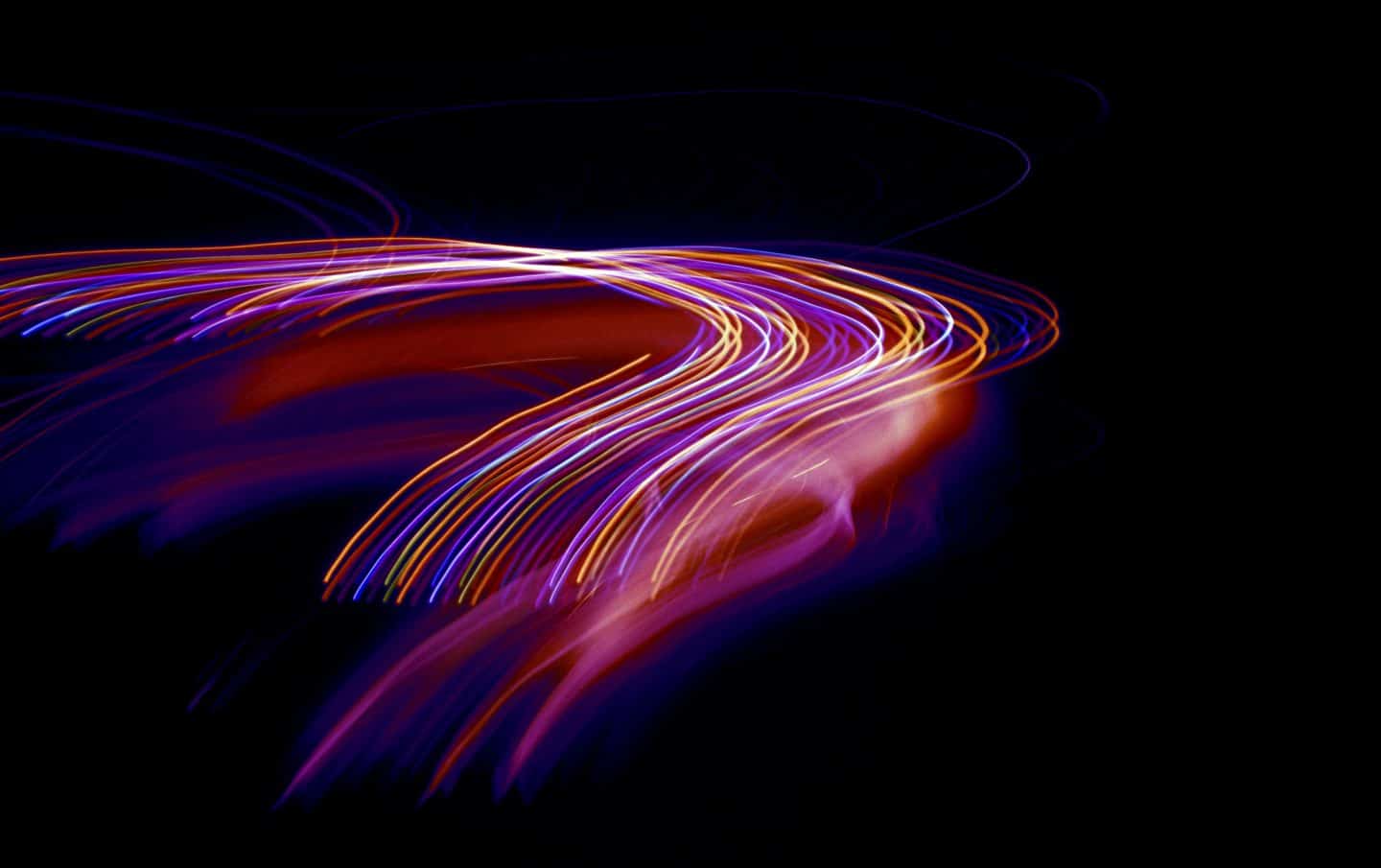K
Kollaboration
„Mehr Demokratie wagen“ hieß einmal der Leitspruch Willy Brandts in den 1970er-Jahren. 20 Jahre Wikipedia belegen eindrucksvoll, warum „Mehr Kollaboration wagen“ ein ähnliches Motto für die 2020er-Jahre werden könnte. Der Wissensdurst der Vielen: wie Kollaboration Demokratie und Wissensproduktion stärkt.
- Commons
- Communitys
- Gemeinwohl
Der Wissensdurst der Vielen – Wie Kollaboration Demokratie und Wissensproduktion stärkt
Ein Essay von Mark Terkessidis
Eine „Ära des tyrannischen Individuums“ sei angebrochen, behauptet der französische Modephilosoph Eric Sadin und beschwört zudem einen „Totalitarismus der Multitude“ und den „Verlust des Gemeinsamen“. Diese Art von Diagnosen wurden 2020 in Deutschland durch die Berichterstattung über der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung illustriert. Die Teilnehmenden erschienen als Ansammlung von desorientierten, verantwortungslosen und hauptsächlich von Verschwörungsideologien geleiteten Einzelnen.
Nun kommt es stets darauf an, auf welche Phänomene sich der Blick von Philosophie und Medien richtet. Offenbar erinnert sich niemand mehr daran, wie das „tyrannische Individuum“ noch 2015 ein beispielloses Engagement für das Gemeinwohl zeigte, als der Staat durch die „Flüchtlingskrise“ überfordert erschien. Ebenso wenig wird betont, dass sich der überwiegende Teil der Bevölkerung in einer wiederum beispiellosen Gesundheitskrise durchaus vernünftig verhält.
Wir können auf neue Arten des Aushandelns schauen, auf die Kollaboration zwischen den wütenden und suchenden Individuen
Sicher lässt sich aktuell eine starke Konzentration vieler Individuen auf die eigene Subjektivität und/oder dogmatische Glaubenssätze beobachten. Aber wir müssen selbst den angeblich omnipräsenten Tyrannen und Verwirrten zugestehen, dass es gar nicht leicht ist, sich dieser Tage in der Welt zu orientieren. Das Wissen – so beschrieb es Jean-Francois Lyotard bereits vor 40 Jahren – hat seine selbstverständliche Legitimation verloren, seine Einbettung in „große Erzählungen“. Wie also können wir wissen und das begründen, was wir wissen, um es intersubjektiv überprüfbar machen? Es bleibt nichts übrig, als über die Kategorien und Methoden und relevanten Felder zu verhandeln. Anstatt also nur Verlust und Verstörung zu beobachten, könnten wir auch auf die praktischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte schauen, auf neue Arten des Aushandelns, auf die Kollaboration zwischen den wütenden und suchenden Individuen.
Selbstverständlich ist Wikipedia ein Beispiel für eine neue Form demokratischer Selbstorganisation des Wissens. Der Erfolg der Enzyklopädien und der Konversationslexika ab dem 19. Jahrhundert war eingebettet in den zunehmenden Wissensdurst eines Individuums, das angesichts der „Volksherrschaft“ mehr Entscheidungen treffen musste. Doch den Umfang, die Themen, die Systematik, die Qualität oder auch die Illustration solcher Lexika beschloss ein Rat von Experten. Dass es gelingen konnte, die Autorität dieses kleinen Kreises potenziell durch die Gesamtmenge aller Individuen mit einem Zugang zu Computer und Internet zu ersetzen – und zudem ein tragfähiges Verfahren für die Zusammenarbeit zu finden, erscheint schon fast als unheimlicher Erfolg.
Seit ihrer Entstehung haben die demokratischen Staaten stets Angst vor den Individuen gehabt, die durch „Volksherrschaft“ plötzlich Mitsprache hatten
Zweifellos gab und gibt es auf dem Weg einer solchen Kollaboration der Individuen zahlreiche Probleme und Fallstricke: individuelle Selbstdarstellungen, politische Einflussnahmen, problematische Einschätzungen von Relevanz oder die mangelnde Überprüfbarkeit von Einträgen. Doch diese Schwierigkeiten sind exakt die Schwierigkeiten jedes demokratischen Prozesses, und Kollaboration bedeutet keineswegs, dass dieser Prozess keine Struktur hat. Es handelt sich nicht um ein Verfahren, das jegliche Autorität abschaffen soll, sondern um eines, das die Zirkulation von Autorität und die Verlagerung „nach unten“ ermöglicht. Dabei geht es weder um Perfektion noch um Utopien, sondern um die Realisierung von Zielen. Das erfordert manchmal auch Eingriffe von „Redaktionen“ – genau dann, wenn der Prozess als Ganzes auf dem Spiel steht.
Mehr Kollaboration wagen – das Motto für die 2020er-Jahre
Seit ihrer Entstehung haben die demokratischen Staaten stets Angst vor den Individuen gehabt, die durch die „Volksherrschaft“ plötzlich Mitsprache hatten. Die zunehmende Freiheit wurde daher begleitet von einer monumentalen Offensive zur Disziplinierung des Verhaltens – in Familien, Schulen, Fabriken, Armeen oder Gefängnissen. Seit mindestens einem halben Jahrhundert entspricht diese Verhaltensnormierung jedoch nicht mehr der Art, wie im Westen gearbeitet, gelebt und auch konsumiert wird. Wäre es nicht ein Schutz vor der angeblichen „Tyrannei“ der Individuen, ihnen – wie bei Wikipedia – mehr Autonomie zu geben, sie aber gleichzeitig in kollaborative Prozess einzubeziehen?
Das erfordert allerdings mehr als „Partizipations“-Verfahren, in denen letztlich das absegnet werden soll, was Politik oder Verwaltung vorher beschlossen haben. In der „Flüchtlingskrise“ hat es alle möglichen Formen von Zusammenarbeit gegeben – was hat die Verwaltung daraus gelernt? In den Kommunen, in denen über die Art der Unterbringung von Geflüchteten von vornherein diskutiert wurde, war die Legitimität dieser Unterbringung danach sehr hoch – welche Schlüsse wurden daraus gezogen? Und hätten die „tyrannischen“ Individuen nicht eine bessere Lösung für den Stuttgarter Bahnhof gefunden als die lebensferne Nomenklatura eines privatisierten Staatsunternehmens? „Mehr Demokratie wagen“ hieß einmal ein Leitspruch der 1970er-Jahre. 20 Jahre Wikipedia belegen doch eindrucksvoll, warum „Mehr Kollaboration wagen“ ein ähnliches Motto für die 2020er-Jahre werden könnte.
Weitere Infos:
Statement
Über Kollaboration
Kollaboration finde ich als Begriff zu unscharf. Commoning drückt viel mehr aus.
Kollaboration heißt im Grunde nichts anderes als Zusammenarbeiten. Das kann auf völlig verschiedenen Grundlagen passieren. Im Kapitalismus als Angestellte, durch die Marktwirtschaft verbunden auf derselben Baustelle als Handwerker*innen. Commoning dagegen ist durch andere Logiken geprägt. Zwei sind für mich entscheidend: zum einen Besitz statt Eigentum, zum anderen Beitragen statt Tauschen.
Besitz statt Eigentum gründet darauf, dass im deutschen Gesetzbuch eine Unterscheidung getroffen wird: Eigentum ist das, was einem rechtlich gehört. Besitz ist das, was man aktiv gebraucht. Wenn man das weiterdenkt, wären Besitzrechte in Ordnung, weil man etwas gebraucht. Aber etwas über die eigene Besitznahme hinaus in Eigentum zu verwandeln, bedeutet: Andere haben es nicht, brauchen es aber – und müssen einem deshalb Geld dafür geben. Das ist beim Commoning ausgeschlossen.
Beitragen statt Tauschen heißt: eine innere Motivation zu haben statt durch äußere Motivation getrieben zu sein. In den meisten Zusammenhängen besteht ja Zwang: Wir müssen unsere Miete bezahlen, also übernehmen wir im Zweifelsfall schlecht entlohnte Jobs. Das ist – um es mit dem alten Wort zu sagen – der Entfremdungseffekt. Oder auch: der Gummibärchen-Effekt. Wenn Menschen für ihr Handeln eine Belohnung bekommen, hören sie auf, von sich aus hilfsbereit zu sein. Die äußere, extrinsische Belohnung macht die innere, die intrinsische Motivation kaputt.

Es geht darum, jenseits dieser Markt- und Tauschlogik selbst entscheiden zu können, was wir mit unserem Leben machen. Es geht um eine ganz andere Form des Zusammenwirkens. Der Schwerpunkt ist: Wir entscheiden für uns selbst, aber auch miteinander, was wirklich wichtig ist.
Auf dieser Basis existiert Commoning oder Peer Production.
Eines der Prinzipien, das uns hilft, aus den gegebenen Logiken auszubrechen, ist die Fülle. Im Kapitalismus wird uns unentwegt vermittelt, alles sei knapp. Das ist etwas, was auch linke Theoretiker*innen oft zu sehr verinnerlicht haben – nur auf die Probleme zu schauen, darauf, was angeblich alles gerade nicht möglich ist.
Als ich vor 15 Jahren ein Buch über das Handeln der Menschen während der Finanzkrise in Argentinien geschrieben habe, bekam ich zu hören, es sei ja logisch, dass in so einer Situation viel solidarisches Wirtschaften möglich werde. Aber das sei eben die Krise.
Wenn wir hierzulande unsere solidarischen Praktiken betreiben – in Umsonst-Läden, mit Foodsharing etc. – dann heißt es: Klar, dass man das machen kann. Solange es noch so viel Wohlstand gibt.
Es geht immer darum, das zu nutzen, was da ist.
Solange wir komfortable Möglichkeiten haben, außerhalb von Tausch- und Marktlogik zu leben und neue Räume aufzubauen, nutzen wir das eben. Als Motor für Transformation.
Bini Adamczak bringt es in ihrem Buch „Beziehungsweise Revolution“ auf den Punkt: Die Zäsur, egal ob als Finanzkrise, Pandemie oder Umsturz – ist nicht die Revolution. Sondern die Revolution ist das, was sich in den Beziehungsweisen zwischen Menschen vorher geändert hat. Und was sich hinterher weiter ändert.
In der Krise greifen zwar Wissen oder andere Denkweisen auf viel mehr Menschen aus als vorher. Aber die Erfahrung, z. B. in Argentinien, zeigt auch: Verbreiten kann sich nur das, was bereits in der Welt ist, was vorher schon gelebt wird: in Beziehungsweisen, die Räume anderer Selbstverständlichkeit oder auch Halbinseln gegen den Strom bilden.
Weitere Infos:
- Friederike Habermann bei Wikipedia
- Wikimedia-Salon “K=Kollaboation: Ohne Zusammenarbeit keine Commons?” mit Friederike Habermann, Mark Terkessidis und Christoph Kappes
Von Ehrenamt und Kollaboration. Ein Interview mit Gereon Kalkuhl
Was bedeutet Ehrenamt für dich persönlich?
Für mich ist das Ehrenamt ein Engagement, um etwas in Umwelt oder Gesellschaft zu verbessern. Aber es ist auch eine Tätigkeit, die einem selbst Spaß machen sollte und bei der man etwas dazulernen kann. Toll ist am Ehrenamt, dass man etwas, was einen stört, direkt verbessern kann.
Ich habe zum Beispiel in der Wikipedia mein Interesse an Schach vertiefen können und viele Artikel zu Schachspielern angelegt oder verbessert. Ich hatte das Erlebnis, dass durch mein Zutun etwas besser wurde. Das war sehr befriedigend für mich. Dann habe ich gemerkt, dass auch noch andere davon profitieren und das hat mich sehr gefreut.
Was ist für dich das Besondere an einem Online-Ehrenamt?
Ein Online-Ehrenamt ist zeitlich und räumlich entgrenzt. Zum Beispiel ist man als Wikipedianer sehr selbstbestimmt, was Arbeitsort und -zeit angeht, und kann auch die Regeln des Projekts selbst mitgestalten. Wir brauchen nur einen Internetzugang und können loslegen. Darüber hinaus ist natürlich die Skalierung und Reichweite online viel höher, als es bei einem Offline-Ehrenamt jemals möglich ist: Was ich in der Wikipedia editiere, kann man sofort weltweit einsehen.
Hast du auch ein Offline-Ehrenamt?
Ja, ich bin zum Beispiel Stadtrat. Das gilt als Ehrenamt. Aber ich bin auch Mannschaftsführer in einem Schachverein, Schiedsmann und war Schöffe an einem Landgericht.
Wie viel Zeit investierst du in die Wikipedia?
Seit 2007 in etwa 2 bis 4 Stunden jeden Tag. Ich glaube, ich habe seitdem wirklich fast keinen einzigen Tag ausgelassen.

Kann das Ehrenamt in den Beruf übergehen oder siehst du das klar getrennt?
Das Ehrenamt ist schon ganz anders, weil es hier keinen Druck und keine Vorgaben gibt. Aber natürlich kann man dabei viel lernen, was sich auch in anderen Lebensbereichen oder im Beruf anwenden lässt. Auf die Wikipedia bezogen zum Beispiel die Fähigkeiten des journalistischen und enzyklopädischen Arbeitens oder das Schlichten von Streit zwischen verschiedenen Parteien, zum Beispiel als Administrator. Denn immer wieder muss man ja in der Wikipedia zu Artikelversionen kommen, mit der alle zufrieden sind, das erfordert schon eine ganze Menge Fingerspitzengefühl.
Dabei muss gesagt werden, dass es Ehrenamt, wie wir es hier leben, nicht überall gibt, denn man muss es sich auch leisten können. Da sind wir in Deutschland in einer privilegierten Situation. In vielen afrikanischen Ländern ist das etwa nicht so einfach, da haben die Menschen sehr existenzielle Sorgen.
Würdest du das, was du in der Wikipedia machst, „Arbeit“ nennen?
Nein. Eher Kunst. Arbeit ist das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Das muss nicht unbedingt Spaß machen, aber man muss ja irgendwie die Miete zahlen. Aber in meiner Freizeit mache ich Dinge, die mich erfüllen; ich mache Musik oder schreibe und drücke mich dadurch aus.
Wie siehst du die Bedeutung des Ehrenamts in der deutschen Gesellschaft?
Wir haben hier zum einen sehr gute Rahmenbedingungen, allein schon dadurch, dass wir in Deutschland Spenden absetzen können. Dadurch wird ehrenamtliches Arbeiten enorm erleichtert. In Nordmazedonien etwa wird auf Spenden eine Steuer erhoben, die es extrem teuer macht – weshalb kaum jemand spendet. Unsere Wikipedia-Community dort hat große Schwierigkeiten, ihre Projekte zu finanzieren.
Zudem hat das Ehrenamt in Deutschland einen guten Ruf, auch wenn es immer eine Minderheit ist, die ehrenamtlich tätig ist. Dennoch wissen die Menschen um die Bedeutung des Ehrenamts und es wird anerkannt, dass darin ein hoher Wert liegt.