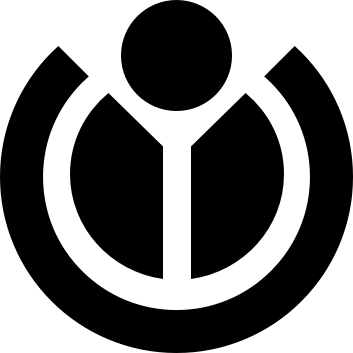Politik im Netz: Zwischen Utopie und Realität
Ein Interview mit Markus Beckedahl
Bietet die wachsende digitale Zivilgesellschaft eine Chance, auf dem politischen Spielfeld in den kommenden Jahren ein freies Netz zu erkämpfen – mit allen Fragen, die daran hängen?
Ein freies Netz, das auf gemeinwohlorientierten Prinzipien basiert, ist eine Utopie, für die wir kämpfen müssen und kämpfen sollten. Und ich hoffe, dass wir dieser Utopie gemeinsam ziemlich nahekommen werden. Es braucht mehr engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich informieren, vernetzen, die gemeinsam für ihre und unsere Interessen eintreten und sich in gesellschaftliche und politische Debatten schlagkräftig einmischen.
Welche Debatten sind die dringlichsten?
Wo soll ich da anfangen? Seit vielen Jahren gibt es immer mehr Überwachungsgesetze. Alles deutet darauf hin, dass wir die Grenzen zum Überwachungsstaat, zur Überwachungsgesellschaft längst überschritten haben. Dagegen müssen wir ankämpfen, um auch weiterhin in Freiheit leben zu können. Das Urheberrecht ist immer noch nicht zeitgemäß. Daran hat auch eine Urheberrechtsreform nichts geändert, die vor allem den Status quo zementiert, viele Alltagspraktiken weiterhin kriminalisiert, beziehungsweise als Urheberrechtsverletzung deklariert. Es bräuchte dringend eine echte Reform, auch, um die Akzeptanz in der Gesellschaft zu steigern. Und schließlich haben wir seit Langem das Problem mangelnder IT-Sicherheit – damit einhergehend auch die fehlende Vermittlung von Digitalkompetenzen durch den Staat. Wir bräuchten konzertierte Aufklärungskampagnen, um mehr Menschen zu befähigen, souverän als sogenannte mündige digitale Bürgerinnen und Bürger im Netz agieren zu können.
„Wenn wir ein Smartphone kaufen, nehmen wir an, die Digitalkompetenz sei im Lieferumfang enthalten.“
Markus Beckedahl
Sehen Sie dabei ausschließlich den Staat in der Pflicht?
Eigentlich sollte all das Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. Von klein auf bekommen wir beigebracht, dass wir nach links und rechts gucken sollen, wenn wir über die Straße gehen. Früher gab es im Programm der Öffentlich-Rechtlichen die Sendung „Der 7. Sinn“, die den Bürgerinnen und Bürgern erklärt hat, wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten haben. Wenn wir dagegen ein Smartphone kaufen, nehmen wir an, die Digitalkompetenz sei im Lieferumfang enthalten. Dabei ist darin ein Fernsehsender eingebaut, die Leute können live drauflosstreamen – aber alle wundern sich, welche gesellschaftlichen Probleme wir mit der Digitalisierung haben. Das hängt zu einem Teil damit zusammen, dass wir alleingelassen werden. Natürlich verlangt dieses Thema nach einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. Trotzdem ist es auch Staatsversagen, dass seit 20 Jahren die Politikerinnen und Politiker zwar in jeder Sonntagsrede die Wichtigkeit und Notwendigkeit von Digitalkompetenz betonen, aber sich Jahr für Jahr nichts davon in den entsprechenden Posten der Landes- und Bundeshaushalte niederschlägt.

Ist dieses Kompetenzproblem in erster Linie eine Generationenfrage?
Vor allem in der Vergangenheit wurde die Debatte um Digitalkompetenz ausschließlich auf die Schulen konzentriert. Das ist schön und gut. Aber 90 Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft gehen nicht mehr zur Schule, es sei denn, sie holen ihre Kinder ab. Wer denkt an die Lehrerinnen und Lehrer, die Kompetenz doch überhaupt vermitteln sollen? Ich glaube, dass Kinder und Jugendliche sich zu einem großen Teil peer-to-peer gegenseitig beibringen können, welche Stolperfallen man im Netz vermeiden sollte. Wohingegen ältere Menschen vollkommen alleingelassen werden – auch mit den Ängsten, mit denen sie vielfach an technische Fragen herangehen.
„Es geht darum, die Utopien Realität werden zu lassen. Oftmals scheitert das einfach an Zeit und Geld.“
Markus Beckedahl
In welchem Ausmaß existiert überhaupt eine digitale Zivilgesellschaft? Ist das, was wir mit dem Begriff verbinden, teilweise auch ein gedankliches Konstrukt?
Die digitale Zivilgesellschaft gibt es. Sie ist ein Teilbereich der klassischen Zivilgesellschaft, und zwar jener Teil, der sich, aus dem Netz kommend, mit Themen der Digitalisierung auseinandersetzt. Ein blühendes Ökosystem, in dem Wikimedia Deutschland sicher einer der größten Player des deutschsprachigen Raums ist. Diese digitale Zivilgesellschaft hat sich auf der Grundlage ähnlicher sozial-technischer Netzsozialisationen entwickelt, getrieben von Werten, für die man eintritt: gemeinsam Arbeiten, gemeinsam Zugang zu Wissen schaffen, keinen Überwachungsstaat akzeptieren, gemeinwohlorientierte Infrastrukturen anstreben, aber auch selbst bauen – basierend auf Open-Source-Prinzipien in der digitalen Welt. Die klassische Zivilgesellschaft betreibt das im analogen Raum.
Gibt es Spielregeln, die in der Netzpolitik anders sind als in der klassischen Politik?
Netzpolitik ist ein Querschnittsthema. Und sie hat eine starke technische Komponente, die man immer mit berücksichtigen sollte. Das mag zwar in der Umweltpolitik nicht anders sein, auf bestimmten Gebieten. Aber in der Netzpolitik ist das ausgeprägter. Hier hängt alles mit der Regulierung von Technik zusammen, mit der Ermächtigung durch Technik. Und damit verbunden sind natürlich Fragen an die Politik: Warum gibt es nicht flächendeckend Makerspaces und Hackerspaces, die gefördert werden? Warum gibt es nicht mehr Plattformen, wo Menschen zusammenarbeiten können, wieso fehlt es generell an Förderung für engagierte Menschen mit guten Ideen für gemeinwohlorientierte Infrastrukturen? Es geht darum, die Utopien Realität werden zu lassen. Oftmals scheitert das einfach an Zeit und Geld. An Engagement mangelt es nicht.