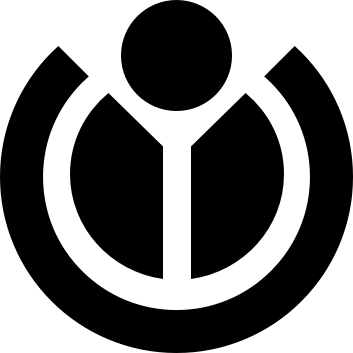Gerechtigkeit als Zweibahnstraße
Was sind die Kernanliegen feministischer Netzpolitik?
FRANCESCA SCHMIDT: Eine feministische Politik für das Netz muss Fragen nach Regulierung stellen, ordnungspolitische Fragen, Zukunftsfragen. Wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns anschauen: Was ist überhaupt feministische Politik?, dann verstehe ich darunter – durchaus in einem utopischen Sinne – eine diskriminierungsfreie Politik, in der Aspekte von Gender, Alter oder Herkunft zu keinerlei Ausgrenzung mehr führen.
Inwiefern kann eine intersektionale Perspektive auch in der Netzpolitik zu mehr Gerechtigkeit führen?
Intersektionalität bedeutet ja, verschiedene Diskriminierungsformen zu beleuchten, die teilweise übereinandergelegt passieren. Es gibt Menschen, die von mehrfacher Diskriminierung betroffen sind. In der Netzpolitik lässt sich das am Beispiel von Überwachung veranschaulichen, bei der Gesichtserkennungssoftware. Es ist bekannt, dass Schwarze Gesichter schlechter identifiziert werden als weiße.*
Das lässt sich noch weiter ausdifferenzieren: Schwarze Frauen werden am schlechtesten erkannt – immer im Verhältnis zu weißer Männlichkeit, die ja in unserer heteronormativen Matrix die Norm darstellt. Solche intersektionalen Analysen sind wichtig, um spezifischer schauen zu können, wie das Problem gegebenenfalls zu lösen wäre: welche Arten von Regulierung es bräuchte, welche Fragen wir überhaupt an Technologie stellen müssen.
Technologie wird unsere Probleme nicht lösen, wenn wir nicht unser Mindset ändern
Francesca Schmidt
Wie könnte Künstliche Intelligenz (KI) feministischer entwickelt werden?
Zunächst mal braucht es ein Grundverständnis, dass Diskriminierung stattfindet – und dass Menschen unterschiedlich von Diskriminierung betroffen sind, je nachdem, wie sie sich verorten oder verortet werden: etwa als Schwarze Frau, als Schwarze lesbische Frau, als Schwarze lesbische arme Frau. Wir müssen alle Arten von Diskriminierung in den Blick nehmen, auch Klassismus, Ableismus.
Wenn es um die Entwicklung von KI geht, hilft uns dieses Verständnis, dass die Welt sehr komplex ist und man sie in dieser Komplexität auch abbilden muss, schon weiter. Natürlich müssten in den Entwicklerinnen- und Entwickler-Teams möglichst diverse Perspektiven vertreten sein. Eins der Probleme ist ja, dass diese Teams überwiegend weiß und männlich besetzt sind. Dementsprechend eng ist oft der Horizont dafür, dass es andere Positionierungen gibt als die eigene. Technologie wird unsere Probleme nicht lösen, wenn wir nicht unser Mindset ändern.

Welche Rolle spielt Hate Speech, wenn es um eine feministische Agenda im Netz geht?
Eine große. Allerdings benenne ich das Problem lieber als digitale Gewalt, weil der Begriff mehr fasst als nur Hate Speech. Von digitaler Gewalt sind in den herrschenden Machtstrukturen wiederum einige Menschen mehr, andere weniger betroffen. Durch internationale Studien wissen wir, dass sie prozentual deutlich mehr Frauen trifft. In Deutschland gibt es leider kaum Untersuchungen dazu. Um auch hier intersektional zu differenzieren: Frauen of Colour, Schwarze Frauen, LGBTIQ-Personen haben das größte Risiko, digitaler Gewalt ausgesetzt zu werden. Das ist schon deshalb ein wichtiges Thema aus netzpolitischer und feministischer Perspektive, weil auch Gewalt im Partnerschaftsbereich zunehmend auf digitale Strukturen zurückgreift, etwa in Form von Cyberstalking oder Online-Harassment.
Welche Rahmenbedingungen kann Politik für mehr Wirksamkeit feministischer Anliegen in der Netzpolitik setzen?
Einerseits kann sie die zivilgesellschaftlichen feministischen Strukturen finanziell besser fördern. Das gilt natürlich auch für Beratungsstrukturen zu digitaler Gewalt. Andererseits sollten die politischen Prozesse viel mehr darauf ausgerichtet sein, Diskriminierung abzubauen – und nicht einfach nur einen Status quo zu erhalten. Auch da wäre eine Änderung des Mindsets notwendig.
„Wir brauchen die Offenheit, den bestehenden Wissenskanon kritisch zu hinterfragen. Auch das ist für mich Wissensgerechtigkeit“
Francesca Schmidt
Die Wikimedia-Bewegung hat das Anliegen „Wissensgerechtigkeit“ strategisch ins Zentrum ihrer Arbeit bis 2030 gestellt. Das Ziel ist, soziale, politische und technische Hürden abzubauen, damit alle Menschen Freies Wissen nutzen und schaffen können. Was bedeutet „Wissensgerechtigkeit“ aus Ihrer Sicht?
Zum einen: Zugangsgerechtigkeit. Das bedeutet, überhaupt den Zugang zu Wissen zu ermöglichen. Genau so hängt daran aber auch die Frage: Wessen Wissen wird überhaupt als solches wahrgenommen und findet Gehör? Aus feministischer Perspektive ist die Wikipedia da kein rühmliches Beispiel. Wissensgerechtigkeit ist eine Zweibahnstraße: Auf der einen Seite muss sie auf der Nutzungsebene ermöglicht und gefördert werden, was damit beginnt, überhaupt literacy herzustellen, also Lese- und Schreibkompetenz. Auf der anderen Seite braucht es die Offenheit, den bestehenden Wissenskanon kritisch zu beleuchten und zu hinterfragen. Das fällt für mich auch unter Wissensgerechtigkeit.
Wie schaffen wir bessere Zugänge zu Wissenscommunitys im Netz?
Zunächst mal ist das eine Frage von physischen Zugängen zum Internet, die ermöglicht werden müssen. Man denkt ja gemeinhin, das sei in Deutschland kein Problem. Gerade in Corona-Zeiten sehen wir aber auch hier ein Gefälle von Zugängen, etwa, wenn es um Homeschooling geht. Der andere Punkt ist, Zugänge zu Inhalten nicht zu monetarisieren. Das fängt bei den Suchmaschinen an, die Algorithmen bauen, um bestimmte Inhalte nach vorn zu bringen, andere nicht. Wer dieses System zu nutzen versteht, kann sich Vorteile verschaffen. Das ist keine Gerechtigkeit, weil daran natürlich auch Ressourcenfragen hängen.
* zur Schreibweise von weiß und Schwarz:
Die Großschreibung von Schwarz verweist auf die Strategie der Selbstermächtigung. Es zeigt das symbolische Kapital des Widerstandes gegen Rassismus an, welches rassistisch markierte Menschen und Kollektive sich gemeinsam erkämpft haben.
Die Klein- und Kursivsetzung von weiß verweist auf die soziale Konstruiertheit von Differenzmarkierungen, wobei weiß üblicherweise unmarkiert bleibt. Da im Gegensatz zu Schwarz dieser Differenzmarkierung kein Selbstermächtigungs- und Widerstandspotenzial innewohnt, wird weiß auch nicht großgeschrieben.
- Mehr dazu in kurz: https://www.gwi-boell.de/de/reach-everyone-planet-kimberle-crenshaw-und-die-intersektionalitaet
- Mehr dazu in lang: Eggers, Maureen Maisha et al. (Hg.) (2005): Mythen, Masken und Subjekte : kritische Weissseinsforschung in Deutschland. Münster: Unrast.