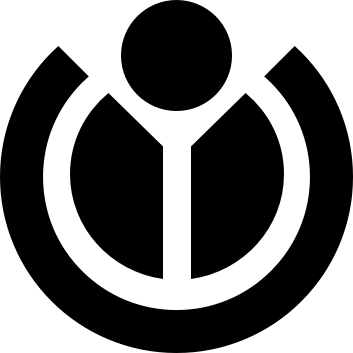XY
XY Ungelöst
Welche Strategien sind heute notwendig, damit sich zukünftige Online-Projekte und ihre Communitys von Beginn an divers und vielfältig entwickeln können? Eines ist klar: Für einen Kulturwandel in den Organisationen braucht es das Vermögen, andere Perspektiven wirklich auszuhalten. Das kann Arbeit bedeuten – lohnt sich aber in jedem Fall.
- Communitys
- Gemeinwohl
Wege zur Diversität: Vorschläge von Julia Kloiber
Welche Strategien sind heute notwendig, damit sich zukünftige Online-Projekte und ihre Communitys von Beginn an divers und vielfältig entwickeln können?
Die erste Antwort ist ganz simpel: Man sollte schon mit einer diversen Gruppe starten. Wenn man ein neues Tool oder ein neues Medium konzipiert, muss das mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen geschehen, aus verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Hintergründen, die von Anfang an Ownership entwickeln. Ownership in dem Sinne: Sie sind Teil des Projekts, es gehört ihnen, sie gestalten mit. So entwickelt sich im besten Fall eine Kultur der Vielfalt, in der es natürlich auch Reibungen geben kann. Aber die Aushandlungsprozesse sind produktiver, wenn die Projekte nicht von einer homogenen Community vorangetrieben werden, die sich in allem einig ist. Allerdings reicht es nicht – und das ist ein weiterer wichtiger Punkt – wenn nur die Teams vielfältig sind. Diversität sollte vor allem auch auf der Führungsebene ausgeprägt sein. Ein Beispiel: Im zivilgesellschaftlichen Bereich erlebt man es oft, dass etwa Frauen in den Organisationen die Mehrheit stellen – in den Leitungspositionen aber dennoch in der Minderheit sind.
Eine Community im digitalen Bereich, die mir als Beispiel für geglückte Diversität einfällt, ist die JSConf-Community, die sehr stark auch feministische Werte verankert hat. Ihre Community-Events künden davon: Es gibt Kinderbetreuung, veganes Essen, Badges, mit denen man Stimmungen ausdrücken kann. Als introvertierte Person nimmt man sich etwa einen roten Badge, wenn man gerade nicht sprechen und auch von niemandem angesprochen werden möchte. Die Community achtet im Detail auf sehr viele Bedarfe und kennt die Bedarfe auch, weil das Gründungsteam von Anfang an divers war und diese Werte der Vielfalt ins Zentrum gestellt hat.
Es gibt Maßnahmen, die tatsächlich sinnvoll und wirksam „Monokulturen“ in Online-Projekten zu vermeiden helfen.
Zum Ersten: sich einen „Code of Conduct“ zu geben, wie ihn auch die Wikipedia am 2. Februar 2021 verabschiedet hat. Einen Kodex, der festlegt, auf welches Verhalten sich eine Gruppe geeinigt hat, was sie nicht akzeptiert. Sexistische Sprache zum Beispiel. So ein Kodex schützt nicht automatisch vor Fehlverhalten, aber man kann sich darauf berufen, auf seiner Basis auch Konsequenzen ziehen. Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören und deshalb öfter als andere Diskriminierung und übergriffigem Verhalten ausgesetzt sind, schauen etwa sehr genau auf den „Code of Conduct“, wenn sie einer neuen Community beitreten: Werde ich hier geschützt, bemüht man sich, in achtsames Umfeld zu bieten? Immer mehr Online-Communitys haben sich in den vergangenen Jahren Codices gegeben, die nicht nur niedergeschrieben sind, sondern auch umgesetzt und implementiert werden. Das hat der Wikipedia zuvor gefehlt: so ein universeller Kodex, der ausdrückt, welche Kultur herrscht, worauf man sich einlässt, wenn man mitschreiben möchte.

Ein zweiter Punkt ist das Community-Management. Bei fast allen Projekten, die mit größeren Gruppen online arbeiten, gibt es Personen, die nicht nur dafür sorgen, dass der „Code of Conduct“ eingehalten wird, sondern darauf achten, dass Menschen sich willkommen fühlen können, dass sie gehört werden, dass darauf geschaut wird, wo noch Mängel bestehen, wo nachjustiert werden muss. Verantwortliche eben, die sich wirklich auf die Community-Arbeit fokussieren. Bei Wikipedia ist die Arbeit natürlich stark inhaltlich ausgerichtet. Aber auch hier könnte es helfen, wenn Diskussionen moderiert würden – auch wenn das streckenweise ein anstrengender Job ist. Darauf sollte man künftig stärker achten.
Für die Wikipedia der Zukunft könnte es überhaupt interessant sein, auch ein paar radikalere Ideen durchzuspielen.
Wie würde eine Wikipedia aussehen, die von Kindern geschrieben ist? Oder von Maschinen? Wie wäre es, wenn man per Zufallsprinzip Artikel löschen und sie neu schreiben ließe? Momentan gibt es für Menschen, die neu anfangen wollen, keine großen Baustellen, bei denen man sofort den Impact sehen könnte.
Das Beispiel Wikipedia zeigt auch, dass es beim Thema Diversität nicht in erster Linie um Political Correctness geht. Denn selbst, wenn wir nur über die Qualität der Inhalte sprechen, ist Diversität relevant. Wenn eine Online-Enzyklopädie den Anspruch hat, einen neutralen Standpunkt zu beschreiben und zu vertreten, dann lässt sich das nicht mit einer sehr homogenen Gruppe an Editoren realisieren. Es würde der Wikipedia guttun, nicht im Status quo zu verharren, sondern sich viel stärker noch in die Zukunft zu orientieren.
Ein freies Netz, das von Vielfalt geprägt ist, in dem sich Menschen austauschen und vernetzen können, ist eine der Grundlagen für eine lebendige Demokratie im 21. Jahrhundert.
Wer das verstehen will, muss sich eigentlich nur vor Augen führen: Was würde das Gegenteil bedeuten? Das Gegenteil wäre ein überwachtes Netz, das von Unternehmen regiert wird. In dem Unternehmen oder Akteure entscheiden, wer wo wann mitmachen darf, wo drastisch zensiert wird und Wissen nur gegen Geld oder über den Verkauf der eigenen Daten zugänglich wäre.
Die vergangenen Monate haben schon gezeigt, was geschehen kann, wenn sich Leute in ihren Bubbles radikalisieren und von der Gesellschaft abspalten. Diese Tendenzen würden durch ein unfreies Internet, in dem es keine Netzneutralität mehr gibt, noch befördert. Schon heute regieren ja die Unternehmen. Es gibt nicht so viele Projekte wie die Wikipedia, die an einem gemeinwohlorientierten Netz mit freiem Zugang zu Wissen arbeiten. Genau die sind aber essenziell für eine demokratische Gesellschaft.
Weitere Infos:
Mehr Diversität wagen
Ein Interview
Welche Perspektiven fehlen Ihnen in der Wikipedia? Wo macht sich konkret bemerkbar, dass es mehr Diversität bräuchte?
Ein Beispiel, das ich bemerkenswert finde: Der enzyklopädische Eintrag zum „Hauskaninchen“ ist vier Mal so lang wie der zum Begriff „Gastarbeiter“. Ich würde behaupten, dass die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter für die deutsche Gesellschaft doch mehr Bedeutung haben. Daran merkt man aber, wie die Kräfteverhältnisse und Interessen bei den Wikipedianerinnen und Wikipedianern liegen. Die Kompetenz rund um das Thema Einwanderungsland und Einwanderungsgesellschaft scheint mir sehr einseitig ausgeprägt zu sein. Es gibt auch viele bekannte Personen of Colour, die keinen biografischen Eintrag in der Wikipedia haben. Ein Youtube-Star wie Rezo ist zu finden, einen Tarik Tesfu sucht man vergebens, obwohl er mittlerweile schon eine Sendung beim NDR moderiert. Davon gibt es viele Beispiele.
Die Wikipedia reklamiert für sich einen neutralen Standpunkt. Kann es Neutralität in einem solchen Wissensprojekt überhaupt geben?
Es ist ja generell so, dass Menschen sich selbst gern eine neutrale Sicht auf die Dinge zuschreiben, aber abweichende Perspektiven für ideologisch beeinflusst halten. Die Kritik, die man an Wikipedia äußern kann, lässt sich auch auf die klassischen Enzyklopädien anwenden: Wer entscheidet, was enzyklopädische Relevanz besitzt, wie es beschrieben ist, ob gegendert wird? Unsere Enzyklopädien sind traditionell weiß, männlich und eurozentristisch geprägt. Auch im Journalismus gab es in Politik und Wirtschaft bis vor wenigen Jahrzehnten fast nur weiße Männer, die das Sagen hatten, warum sollte das bei Nachschlagewerken anders sein? Bei Wikipedia hat man aber eine andere Erwartung, weil das Projekt Offenheit verspricht. Es will eine Enzyklopädie von allen für alle sein. Das scheint nicht zu funktionieren. Theoretisch darf natürlich jede und jeder mitschreiben, aber gerade Menschen mit einem sehr rassismuskritischen Blick oder Feministinnen machen die Erfahrung, dass ihre Beiträge von der Community abgelehnt werden und ihre Perspektive somit keinen Platz hat.
„In meinem Wikipedia-Eintrag heißt es: Ferda Ataman wurde in Stuttgart geboren und wuchs in Nürnberg auf. Ihre Eltern stammen aus der Türkei.“
Ferda Ataman

Generationen sind mit einem Wissenskanon erzogen worden, der beispielsweise postkoloniale Perspektiven komplett ausgeblendet hat. In der Schule wurde ihnen beigebracht, Kolumbus habe „Amerika entdeckt“ – was heute zu Recht als imperiale Lesart von Geschichte gilt. Kann eine Enzyklopädie Prozesse eines lebenslangen Lernens abbilden?
Wikipedia bildet diese Prozesse noch am besten ab. Schon dadurch, dass den Artikeln längenmäßig keine Grenzen gesetzt sind, ist es möglich, verschiedene Standpunkte und auch Kontroversen zu beschreiben – wofür sich ja viele Beispiele finden, gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie. Das hätte es früher bei Enzyklopädien nicht gegeben, dort wurde das aufgenommen, was eben Wissensstand war. Leider glückt Wikipedia die Abbildung strittiger Facetten oft nicht bei gesellschaftspolitischen Themen – und speziell nicht in den Bereichen, die Diversität betreffen.
Am Begriff „Indianer“ zeigt sich, wo Wikipedia steht. In dem Eintrag heißt es zwar: „Indianer ist eine Fremdbezeichnung durch die Kolonialisten“. Den Zusatz hätte es vor 20 Jahren, als das Projekt an den Start gegangen ist, vermutlich noch nicht gegeben. Trotzdem trägt der Eintrag nur den Titel „Indianer“, es ist darin die Rede von der „indianischen Bevölkerung“ und erst im 10. Absatz steht, dass viele so bezeichnete Leute den Begriff ablehnen. Ebenso findet sich eine völlig rassismusunkritische Definition des Begriffs „Blackfacing“. Und ein begrenzter Horizont zeigt sich für meine Begriffe auch daran, wie Biografien gestaltet sind.
Inwiefern?
Gerade bei Menschen mit Migrationsgeschichte oder solchen, bei denen vermutet wird, sie seien keine Biodeutschen, wird spätestens im zweiten Satz erzählt, woher die Eltern stammen. Auch in Horst Seehofers Eintrag gibt es zwar einen Absatz zu „Herkunft und Familie“, in dem man erfährt, dass sein Vater LKW-Fahrer und seine Mutter Hausfrau war. Aber die Genealogie ist längst nicht so prominent platziert. Als ich diese Kritik öffentlich geäußert habe, hat mir ein empörter Wikipedianer geschrieben, es werde bei allen Menschen gleichermaßen auf die Herkunft verwiesen, das sei doch von öffentlichem Interesse. Meine Beobachtung ist aber eine andere. In meinem eigenen Eintrag heißt es gleich am Anfang: „Ataman wurde 1979 in Stuttgart geboren und wuchs in Nürnberg auf. Ihre Eltern stammen aus der Türkei“. Im Weltbild der Wikipedia gibt es noch immer echte Deutsche – und es gibt Eingewanderte. Ich bin Verfechterin der Auffassung, dass es wurscht ist, wo sich die Vorfahren vermehrt haben.
„Ich bin nicht dafür, dass Frauen nur noch über Feminismus und migrantische Menschen nur über die Einwanderungsgesellschaft schreiben sollten.“
Ferda Ataman
Wenn darüber diskutiert wird, dass zum Beispiel mehr Beteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte an der Wikipedia wünschenswert wäre, kommt schnell auch die Erwartung auf, es gäbe dann mehr Einträge über das türkische Dorf X oder den griechischen See Y – ist das auch wieder eine Verengung auf Herkunft? Oder einfach Spezialwissen?
Zumindest werden Menschen, die aus diesem türkischen Dorf X kommen, einen anderen Blick darauf haben als solche, die nur als Touristinnen oder Touristen vorbeigeschaut oder im Reiseführer darüber gelesen haben. Insofern finde ich es schon wichtig, dass sich Leute einbringen, die persönliche Bezüge oder Lebenserfahrungen zu bestimmten Themen mitbringen. Das macht die Wikipedia ja auch aus. Weder ein Duden noch ein lexikalischer Verlag könnte oder wollte sich solche Expertisen einkaufen. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass Frauen nur noch über Feminismus und migrantische Menschen nur über die Einwanderungsgesellschaft schreiben sollten. Es wäre für Wikipedia doch mal ein spannendes Experiment, Menschen mit verschiedener Perspektive zum selben Thema Beiträge verfassen zu lassen – zum Beispiel den Mauerfall aus west- und ostdeutscher Sicht abzubilden. Die Ergebnisse würden garantiert komplett unterschiedlich ausfallen.
Wie könnte man in Ihren Augen diversere Communitys gewinnen?
Das ist eine Herausforderung. Ich bin ja viel damit befasst, wie sich mehr Diversität in den Medien erreichen ließe. Am liebsten wollen die Verantwortlichen hören, sie müssten die Stellenausschreibung nur so oder so gestalten, dann ergäbe sich Diversität von selbst. Aber was es tatsächlich braucht, ist ein Kulturwandel in den Organisationen. Und das ist ein langer Prozess. Ein erster Schritt ist, die Botschaft auszusenden – wir wollen diverser werden. Es ist nicht schwer, Menschen anzusprechen. Aber dann braucht es das Vermögen, andere Perspektiven auch wirklich auszuhalten. Das kann Arbeit bedeuten – lohnt sich aber in jedem Fall.
Weitere Infos: